Die kriminelle Karriere des Dieter Schulz sieht aus wie ein Schelmenroman – ist aber Realität
Das Leben von Dieter Schulz, geboren 1941, seine Lebensumstände und seine „Karriere“ bilden den Kern dieser Publikation[1]. Schon der einleitende Nachruf kündet von einem außerordentlichen Leben. Ausgangspunkt ist seine Autobiographie, geschrieben während eines 10jährigen Knastaufenthaltes und nach Aufforderung fortgeführt bis in die Zeit seines körperlichen Verfalls. Dieses Leben ist spannend. Vergangenheiten werden lebendig:
- Das Kriegsende und die Nachkriegswirren bis 1949 in Ostpreußen, die Rote Armee und die Überlebensbedingungen der verbliebenen Deutschen. Schulz lernt in dieser Zeit Russisch, die Grundlage für die erfolgreichen Schiebergeschäfte des 10/11-jährigen (!) später in der DDR.
- Seine Heimkarriere begann eher zufällig am 17. Juni 1953. Doch was für eine Karriere, bestimmt durch die Unfähigkeit der Heimerziehung in der DDR und abenteuerliche Heim-Fluchten, spannend erzählt.
- Im Westen, vom Vater abgeschoben, muss er sich durchkämpfen, bekommt eine erstklassige Kellnerausbildung, doch der Balkonsturz des schwarzen Liebhabers seiner Frau bringt ihm die erste Zuchthausstrafe ein.
- Eher zufällig beginnt er mit akribisch geplantem Automatenbetrug, hat immer wieder Pech mit seinen Helfern, besonders mit seinen Frauen, – das auch fürderhin.
- Schließlich misslingt ihm – auch eher zufällig – der große Coup: Ein riesiges Drogengeschäft, das er mit selbstgedruckten „Blüten“ bezahlen und dann untertauchen will. Doch ein bewaffneter Banküberfall hat mörderische Folgen.
Schulz inszeniert sich gekonnt. Lange ist man geneigt, alles zu glauben. Doch sein Sohn Sascha fügte noch ganz andere und sehr überraschende Aspekte bei und korrigiert damit das saubere Bild vom Verbrecher aus unheilvollen Verhältnissen. Doch ein Kämpfer war Schulz sein Leben lang. Klein, aber oho. Ein Aufstehmännchen.
Dieses Leben fordert kriminologische Forschung geradezu heraus. Wie kommt es zu Devianz, wie pflanzt sie sich fort? Die Publikation steht in ehrwürdiger Tradition, denn schon der Oberamtmann von Sulz am Neckar, Jacob Georg Schäffer, (1745-1814) erkannte die sozialen Missstände als Quelle von Kriminalität und wollte die noch jungen Kinder der „Janoven“ in Pflegefamilien untergebracht wissen.
Dieter Schulz als Person ist eher bedeutungslos. Zwar beschreibt er sein kleines Leben in faszinierender Weise. Doch es hülfe alles nichts. August Gottlieb Meißner (1753-1807) schrieb ganz richtig: „Sobald der Inquisit nicht bereits vor seiner Einkerkerung eine wichtige Rolle im Staat gespielt hat, sobald dünkt auch sein übriges Privatleben, es sei so seltsam gewebt, als es immer wolle, den meisten Leuten in der sogenannten feinen und gelehrten Welt viel zu unwichtig, als darauf acht zu haben, und vollends sein Biograph zu werden.“
Warum also ist Schulz nicht nur für Kriminologen interessant? Er entwirft beispielhaft, lehrreich und unterhaltsam ein Sittengemälde seiner Zeit. Zwar fragt er: „War es den Aufwand wert, dieses beschissene Leben vor den Bomben zu retten?“ Seine Antwort lautet aber: „Mein Leben sollte nicht unbedingt als Beispiel dienen, deswegen ist mein Leben lesenswert!“
[1] Man kann sie kostenfrei herunterladen. https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/115426/T%c3%bcKrim_Bd.%2045.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Die Druckversion (print-on-demand) kann bestellt werden beim Institut für Kriminologie der Eberhard Karls Universität Tübingen, Sand 7, 72076 Tübingen, 07071 / 29-72931, Mail: ifk@uni-tuebingen.de
»Wenn der Richter das gelesen hätte, dann hätten Sie keine zehn Jahre gekriegt.« XIX
 Dieter Schulz
Dieter Schulz
Der Ausreis(ß)ende
oder
Eine Kindheit,
die keine Kindheit war
Neunzehntes Kapitel
Überhaupt, in der DDR gab es keine Kriminalität[1]
Etwas besser wurde es dann aber schon im Sommer 49. Es wurde wieder einmal eine Sammelaktion veranstaltet. Von Seiten der Russen, versteht sich. Wieder stand eine lange Reihe von Viehwaggons auf einem Bahnhof in Insterburg bereit. Diesmal aber mit einer Lok vorne und einer hinten. Ich weiß nicht mehr die Anzahl der Passagiere, die in solch einem Waggon untergebracht wurden. Jedenfalls hatte jeder genügend Platz, um sich ausstrecken zu können. Einmal am Tage wurde der Zug auf einsamer Strecke gestoppt. Dann wurden die Riegel draußen an der Türe hochgeschoben und wir durften unsere Beine vertreten oder unsere Notdurft verrichten. An beiden Seiten des Zuges standen aber in gleichmäßigen Abständen bewaffnete Soldaten und passten auf, dass auch ja niemand den Zug versäumte, wenn er weiter fuhr. Für die übrigen Stunden der Fahrt konnte man ein Brett im Waggon zur Seite schieben und sich etwas Wind um den Hintern wehen lassen. Manchmal fuhr der Zug ja auch. Doch viel öfter blieb er irgendwo auf einem Nebengleis stehen. Mal musste ein entgegenkommender Zug vorbei gelassen werden, ein anderes Mal wurde auf Verpflegung gewartet. Dann fehlte wieder Kohle oder musste deswegen wieder ein Stück zurück fahren, um dort die Tender wieder aufzufüllen. Welche Gründe uns auch immer für das langsame Vorwärtskom men genannt wurden. Nach genau 20 Tagen Hin- und Hergeschiebe kamen wir in Löbau an. [2]
[2]
Ein riesiges Barackenlager nahm uns auf. Ich weiß noch, dass ich die meiste Zeit um die Baracken schlich und nach Kippen Ausschau hielt. Der russische Machorka war meiner Mutter längst ausgegangen. Irgendwann in der stressigen Zeit hatte sie zu rauchen begonnen. Mein Vater war später darüber sehr entsetzt. Selbst aber ließ er seinen Rotzkocher, wo immer ein Stumpen drin steckte, nie ausgehen. Wer in Löbau den Sachbearbeitern angeben konnte, dass er im „Westen“ Verwandte hatte, wurde dorthin auf Reisen geschickt. Wer aber gar keine Ahnung hatte wo, wenn überhaupt, Verwandte wohnten, der wurde nach Gutdünken irgendwohin verwiesen.
Umlernen bei der Orientierung
 Wir landeten in Leipzig-Engelsdorf.[3]
Wir landeten in Leipzig-Engelsdorf.[3]
Eine Einraumwohnung für drei. Toilette auf halber Treppe. Unten im Haus gab es einen Kaufmannsladen. Eines Tages schickte meine Mutter mich los, um Mostrich zu holen. „Haben wir nicht“, hieß es da. Ich suchte und fand einen anderen Laden, ich glaube, es war ein Metzgerladen. Ich fragte nach Mostrich, „haben wir nicht!“. Ich irrte weiter durch die Straßen. Ich sah wieder einen Laden. Ich rein. „Ich hätte gern Mostrich“ sagte ich zu der freundlichen Verkäuferin. Die schaute mich ganz komisch an. „Sag mal, du warst doch gerade hier. Wir haben keinen Mostrich“.
Bevor ich es richtig verarbeitet hatte, was die Frau mit dem, du warst doch gerade erst hier, gemeint hatte, mischte sich eine Kundin ein. „Natürlich haben sie Mostrich! Der Junge möchte Senf haben“, übersetzte sie mein Ostpreußisch ins Deutsche. Die Verkäuferin hatte begriffen und ich gelernt, dass es hier zwar keinen Mostrich, aber dafür Senf gab, was dasselbe sein sollte. Mir sollte es recht sein, Hauptsache ich kam nicht mit leeren Händen zu meiner Mutter. Mutter war nämlich etwas kränklich! Ich bekam meinen Mostrich, entschuldigung, Senf und ging zur Türe, die so schön bimmelte, wenn sie auf- oder zuging. „Sag mal, bist du nicht der kleine Schulz, der bei uns oben im Haus wohnt?“ fragte mich die Verkäuferin. Ich? Wieso wohnte ich hier oben im Haus? Desto länger ich in diesem Laden stand, umso bekannter kam er mir vor. Ja, richtig. Es war genau der, wo ich als erstes drin gewesen war. Folglich war ich ja auch gleich zu Hause. Ich hatte bei meiner Rumrennerei und ohne mich vorher mich zu vergewissern, wie meine Umgebung aussah, auf die Suche nach Mos… Senf gemacht. Tja, in den Trümmern von Königsberg oder Insterburg hätte ich mich nicht verlaufen. Ich musste ganz schnell umdenken lernen. Hier richtete man sich nicht mehr nach Mauern, die jeden Monat umzukippen drohten oder an Fenster, die eigentlich gar keine Fenster mehr waren, aber doch immer wieder anders aussahen. Mal rußgeschwärzt, mal nur zur Hälfte herausgeschossen. Hier konnte man sich an farbigen Tor-Tür Eingängen orientieren, an Bäumen und Sträuchern, die vor oder in der Nähe der Häuser noch wuchsen. Oben in der Wohnung wurde ich wegen meines langen Wegbleibens getadelt.
Syphilis! Auch ein Kriegsgeschenk.
Dann war Mutter fast ein halbes Jahr lang nicht da. Keiner, der so richtig schimpfen tat. Auf das Gezänk meiner Schwester gab ich nichts. Es wurde mir gesagt, dass meine Mutter schwer krank sei, aber bald wieder kommen würde. Viel später erst erfuhr ich, welche Krankheit meine Mutter so lange im Krankenhaus aufgehalten hatte. Syphilis! Ziemlich weit fortgeschritten. Auch ein Kriegsgeschenk.[4] Abgesehen davon, dass es von nun an immer genügend Brot gab, kam alles andere doch bald wieder aus der Nase wieder raus. Tagein tagaus Erbswurstsuppe[5]. War ja genau so ekelhaft auf die Dauer wie das ewige „Spinat-essen“ (Brennnessel und Melde[6]).
Etwas ganz Neues kam in Leipzig auf mich zu. Heutzutage freuen (?) sich Kinder schon ab dem vierten Lebensjahr darauf, endlich in die Schule zu kommen. Ich kannte das Wort Schule kaum. Jedenfalls hatte ich keine genaue Vorstellung davon. Bald schon sollte ich eine davon bekommen. Mit meinen fast neun Jahren, musste ich mich mit solchen Rotzlöffeln von 6jährigen in einem Raum aufhalten. Ganz ruhig auf einer Bank sitzen, das ABC lernen und anhand einer Uhr die Zahlen von 1-12 auswendig lernen. Aus einem A und einem U und noch einem A wurde dann das Wort aua, dann Auto, Autobus usw. Meine Schiefertafel und den daran hängenden Schwamm nebst Griffel hatte ich aufs Sorgsamste zu pflegen, wurde mir gesagt. Das alles hätte Vater Staat für mich bezahlt, und Vater Staat verlangte von mir, dass ich sein Eigentum schütze. Dabei wurde uns doch aber gleichzeitig beigebracht, dass alle Besitztümer dem Volke gehörten. Damit ich auch ja die richtigen Buchstaben in der richtigen Reihenfolge aufschrieb, drückte meine Schwester, diese Zicke, meinen Zeigefinger, mit dem ich auf den zu bestimmenden Buchstaben wies, so fest auf die Fibel, dass mir der Finger dabei fast abbrach, wenn ich mich mal verhaute. Oh ja, das Lesen und Schreiben hat sie mir schon beigebracht. Möchte nur mal wissen, woher sie das eigentlich konnte?
Alles süße Bonbons! Alle für mich!
Weihnachten 49. Es wurde wieder darüber gesprochen, dass es so etwas überhaupt nicht gab. Jahrelang wurde lieber darüber geschwiegen, um den Fragen der Kinder zu entgehen. Mutter war für kurze Zeit von der „Kur“ heimgekehrt. Es gab Tannenzweige und Kerzen, aus Buntpapier geschnippelte Sternchen und Engel. Räucherstäbchen und Wunderkerzen. Verwunderte Augen bei mir! Was es nicht alles gab auf dieser Welt!? Mein allererstes Spielzeug (mit dem ich auch etwas anzufangen wusste) bekam ich. Ein Pappmachépferd! Etwa 20 cm groß. Das war aber noch nicht alles. Meine begehrlichen Blicke, immer wenn wir beim Bäcker vorbei gingen und ich die Süßigkeiten nicht aus den Augen ließ, waren meiner Schwester nicht entgangen. Sie musste bei meiner Mutter gepetzt haben. Eine halbe Monatsration der Zuckermarken opferte meine Mutter dafür. Ich bekam eine ganze Tüte voll. Kleine, etwa jedes einen Zentimeter groß, rote, blaue, weiße, grüne und andere Farben, Sterne, Halbmonde, Buchstaben und verschiedene Tiere waren an den Formen zu erkennen. Alles süße Bonbons! Alle für mich! Ich hatte eine kleine Ecke für mich. Auf einem Stück es Pappe reihte ich sie zunächst nach Farben, dann nach Formen und Buchstaben auf. Die Sorte, die die längste Reihe bildete, wurde nach und nach, Stück für Stück in den Mund gesteckt. Wo denken sie hin? Nicht doch! Nein, nicht alle auf einmal, jeden Tag wurde neu geordnet und gezählt. Am 27. Januar hatte ich immer noch genug davon, um meinen Geburtstag zu feiern. Ein Nachbarsjunge bekam sogar aus jeder Reihe eines ab. Die Schule machte Fortschritte. Es gab nur noch sehr selten etwas mit dem Rohrstock auf die Finger, oder ein Stück Kreide an den Kopf geworfen, wenn man den Unterricht störte. Ein Lehrer hatte die hässliche Angewohnheit einem mit einer verblüffenden Zielgenauigkeit den nassen Schwamm von der Tafel an den Kopf zu werfen, sobald er einen Sünder ertappt hatte. Ich habe eigentlich nur seine Treffsicherheit bewundert, auch aus der Drehung heraus, wenn man glaubte, er schreibe an die Tafel. Sonst habe ich ihn gehasst! Sein Schlüsselbund, welches er ebenfalls als Wurfgeschoß benutzte, tat gemein weh, wenn es traf. Meistens traf er auch damit. Dafür schmuggelte ich ihm ab und zu mal eine tote Maus, Ratte oder gar eine halbverweste Katze in seine Aktentasche. Das machte ihn aber auch nicht freundlicher uns Schülern gegenüber. Bloß gut, dass ich dieses Ekel nur ein knappes Jahr ertragen musste. Die Schule stand 1990 immer noch an ihrem Platz!
Wir zogen erst noch mal innerhalb von Engelsdorf um. Meine Mutter durfte dort in einem schönen großen Haus einen alten Mann (tot-)pflegen. Danach gehörte das Haus automatisch dem Staat, da keine Erben vorhanden waren. Dass der alte Herr König (so hieß er wirklich!) meiner Mutter das Haus vermacht hatte, wollte man nicht wahr haben. Ein paar Möbel und vom Geschirr durften wir mitnehmen.
Dann durfte meine Mutter sich am Aufbau des Sozialismus beteiligen.
Welche Reichtümer wir da in unseren Händen hatten, wurde uns erst viel zu spät bewusst. Nach und nach wanderte der Zierrat, der an Möbeln dran hing, in den Ofen. Alles geschnitzte Handarbeit aus bestem Holz und von antiquarischem Wert. Und erst eine riesige Menge echten Meißner Porzellans, nebst kleinen Nippfiguren. Alles mit den Schwertern dieser so berühmten Porzellanmanufaktur versehen. Man stelle sich vor, wir hatten kaum genug, um die Schüsseln zu füllen, die das blaue Zwiebelmuster zeigten, und wussten gar nicht, wie reich wir waren. So mancher Nabob hätte dafür ein Vermögen auf den Tisch geblättert. Nur, wir lebten im Jahre 50 in der DDR! Um einmal an ein Eis zu kommen oder anderes Begehrenswertes, was ein Kinderherz höher schlagen lässt, musste ich schon selbst dafür sorgen, dass ich es auch bekam. Ich sammelte ganze Schuhkartons voll Maikäfer (richtige Maikäfer, solche die heute in der Zeitung abgebildet werden, sofern man solch ein Exemplar vorweisen kann!) und bekam dafür ein paar Groschen von jemandem, der seine Hühner damit fütterte. Was derjenige mit den Mäusen fütterte, der pro Stück lebender Maus 10 Pfennige zahlte, ist mir nicht bekannt geworden. Wir machten aber zu zweit oder dritt Jagd auf diese possierlichen Tierchen. Nachdem die Kartoffelfelder abgeerntet waren, machten wir die größte Beute. Unter dem zuhauf geworfenen Kartoffelkraut hielten sie (die Mäuse) sich am liebsten auf. Zu dritt ging es am besten. Einer hob mit einer Heugabel den Haufen hoch und die anderen gut postiert um den Haufen, brauchten nur noch möglichst schnell so viele als es nur ging von den davon huschenden Pelztierchen einfangen.
Das Karussellfahren auf dem Dorfanger, wenn mal eins da war, hatten wir umsonst. Oder zumindest fast umsonst. Zwei oder drei schoben oben auf einem breiten Brett herum laufend das Karussell, die die mitfuhren mussten einen Groschen löhnen. Hatte man nun ein paar Runden geschoben, durften das die anderen tun und man selbst durfte sich schieben lassen. War doch eine nette Geste des Karussellbesitzers, finden Sie nicht auch?
Dann durfte meine Mutter, wieder vollkommen genesen, den armen Herrn König totgepflegt, sich am Aufbau des Sozialismus beteiligen. Damit sie ihre Arbeitskraft auch gut dafür einsetzen konnte, bekamen wir schon eine Stadtwohnung. Dabei spielte es überhaupt keine Rolle, dass man dort keinen Gegenstand gerade hinstellen konnte. Die Treppe ließ es zu, dass wir auf ihr unbeschadet unsere geerbten Möbel hinaufschleppten. Ansonsten wiesen die Fußböden ein solches Gefälle auf, dass wir das Regenwasser gar nicht aufwischen brauchten, was von oben herein kam. Alles lief immer in die gleiche Ecke, ziemlich schnell sogar, und versickerte dort genau so schnell. Einbrecher hätten bei uns keine Chance gehabt. Wer sich nicht im Haus auf jedem Quadratmeter genauestens auskannte, brach sich unweigerlich das Genick, schon auf der Treppe. Da meine Mutter bei ihrem Steineklopfen nur Aktivistin wurde, aber keine Reichtümer ansparen konnte, blieben wir von solchen Heimsuchungen verschont. Überhaupt, in der DDR gab es keine Kriminalität. In diesem Staate war das Volk in allen Belangen glücklich und zufrieden. Bei einem Wochenlohn von ca. 60 Mark, bar auf die Kralle, kostete ein Pfund Kaffee, wenn es ihn mal gab, ganze 40 Mark. Zigaretten gab es auch schon zu erschwinglichen Preisen. Sogar einzeln konnte man sie in der nächsten Kneipe kaufen.
Lieber einen warmen Hintern als einen leeren Schrank in der Wohnung.
Für ein Dreipfundbrot brauchte man nur ganze 72 Pfennige auf den Ladentisch zu legen. Fleisch/Fisch gab es auch. 480 Gramm im Monat. Auf PC Lebensmittelmarken[7] versteht sich. Dafür aber war diese Menge garantiert. Mit oder ohne Knochen, das lag immer ganz an dem Verkäufer. Der musste ja auch noch etwas für seine „zahlenden“ Kunden übrig behalten. Holz und Kohle gab es auch auf Bezugsschein. Nur der Winter durfte nicht zu hart ausfallen. Dann vergriff man sich eben an Möbelstücken. Lieber einen warmen Hintern als einen leeren Schrank in der Wohnung.
Ich hatte es nicht sehr weit bis zur Ernst-Thälmann-Straße. Eine der beliebtesten und größten Straßen, die ich bis dahin je kennengelernt hatte. Ich lief gern dorthin, wenn es mal was zu besorgen gab. Irgendjemandem war irgendwann mal der Einfall gekommen, dass man eine Straße auch mit einer Holzdecke versehen könnte. Irgendjemand anders hatte dies auch für gut befunden und ließ diese Idee in die Tat umsetzen. Mir ist nie in meinem weiteren Leben solch eine Straße wieder unter die Füße gekommen. Dabei bin ich schon über viele Straßen in vielen Städten und Ländern gelaufen. Diese Straße also war für mich das Größte. Über eine Kreuzung waren Drähte gespannt. Schön hoch. Dort wo die Drähte zusammenliefen, logischerweise in der Mitte der Kreuzung, hing eine Ampel. Gar nicht zu übersehen – im Uhrzeigersinn drehte sich ein Zeiger. Oben und unten zeigte der Zeiger auf grün. Rechts und links auf rot. Natürlich galt das immer nur für die Richtung aus der man kam.[8] Dort wo ich das eine Mal, wovon ich gerade rede, über die Straße wollte, zeigte der Pfeil ganz eindeutig für mich die Grünphase an. Nicht nur noch ein bisschen, wo das Hinüberkommen über die Straße schon mit einem Risiko verbunden gewesen wäre. Ich hätte ganz einwandfrei über die Straße schleichen, dabei eine Schnecke an der Leine mitführen können.
Soviel Glück hat nicht jeder, dass er einen Unfall hat und aus dem Auto, das ihn gerade beinahe zu Tode gefahren hätte, gleich ein Arzt aussteigt.
Wie ich schon fast auf der Mitte der Fahrbahn bin, der Zeiger der Ampel hatte gerade etwa eindrittel der grünen Marke überschritten, war es bereits zu spät. Schließlich, und gerade als Kind, verlässt man sich darauf, dass die Erwachsenen die Verkehrszeichen beachten. Das ich heute noch lebe, habe ich nur dem Umstand zu verdanken, dass, irgendjemandem irgendwann mal der Einfall gekommen war, dass man eine Straßendecke auch aus Holz herstellen könne, und das irgendjemand anders diese Idee auch hatte verwirklichen lassen. Der gute alte Petrus da oben hatte auch seinen Anteil daran, dass ich heute noch am Leben bin. Wäre die Holzstraße nämlich nicht vom Regen so glitschig gewesen, hätten mich die Räder des Autos glatt überrollt. So aber schoben mich die abgebremsten Räder des Wagens nur ein paar Meter über das nasse Parkett. Parkettartig waren die Holzstücke auf der Straße verlegt. Hatte ich also ein Glück. Soviel Glück hat nicht jeder, dass er einen Unfall hat und aus dem Auto, das ihn gerade beinahe zu Tode gefahren hätte, gleich ein Arzt aussteigt. Dieser Arzt hatte es nur ganz eilig gehabt, weil er dringend zu einem Patienten musste. Sagte er! Doch nun hatte er auf einmal eine Menge Zeit übrig. Die aufgebrachte Menge, die alle Zeugen von seinem Verschulden waren, hätten ihn am liebsten gelyncht. Sicher, ich war wohl ziemlich blass um die Nase, der Schreck war aber größer als der Schmerz. Mein Hemd war hinüber, die Hose taugte auch nicht mehr für die Schule, reichlich Hautabschürfungen, die aber von dem grünlichen, moosähnlichem Zeug herrührte, das aus den Ritzen des Parketts stammte, und Schlamm, der mich nicht zuletzt so gut über die Straße hatte gleiten lassen, bedeckten meinen Körper und ließen alles viel gefährlicher aussehen, als es war. Der besorgte Arzt, der mehr Angst vor der Polizei zu haben schien als vor der Menge, beruhigte und säuberte mich, mit Jod, dieses Scheusal. Erst jetzt hatte ich Schmerzen, und das nicht zu knapp. Er wurde nicht gelyncht! Ich jammerte mehr wegen meiner schönen Sachen, die dabei unbrauchbar geworden waren und … wegen des Jods auf meinen Schürfwunden. Genau gegenüber auf der anderen Straßenseite gab es ein Konfektionsgeschäft. Der Doktor ging dort mit mir hinein. Und, ich bekam die erste lange Hose meines Lebens. Bis dahin trug ich, wie fast jeder andere Junge, wenn es kälter wurde, ein Leibchen mit Strippen dran und lange Strümpfe. Heute besser als Strapse bekannt und nur noch zur Erotisierung der Männer angewandt. Ein Zwanziger diente als Trostpflaster nachdem ich neu eingekleidet den Heimweg antrat.
Wer hat schon mal versucht eine erschreckte Glucke zu beruhigen?
Leider! war meine Mutter schon zu Hause. Misstrauisch wegen meiner funkelnagelneuen-piekfeinen Kluft hieß sich mich diese sofort auszuziehen, weil sie glaubte, die könnte ich mir nur unrechtmäßig angeeignet haben. Überzeugt davon, dass ich ihr die Wahrheit gesagt hätte, dass die Sachen mir gehörten und sie gerne mit mir in das Geschäft gehen könnte, um es sich bestätigen zu lassen, war sie der Sorge enthoben, ihr Sohn sei ein Dieb. (Die kleinen Dinge, die wir in unserer Heimat hatten mitgehen lassen, gehörten zu Überlebenskampf, wie sie zu sagen pflegte!) Trotzdem bestand sie drauf, dass ich diese schönen Sachen, die ich mir verdient hatte, wie ich ihr glaubhaft versicherte, gleich ausziehen solle, sie seien zu schade, um damit in der Wohnung oder auf der Straße rumzutoben. Liebe Mutter, wärest du nicht mit so einer robusten Natur ausgestattet gewesen, hätte der Krieg uns nicht schon abgehärtet, du wärst bestimmt in Ohnmacht gefallen, als du endlich, nach längerem Sträuben meinerseits, deinen Willen durchgesetzt hattest und ich mich auszog! Ich habe es ja bereits erwähnt, alles sah viel schlimmer aus, als es war! Zweifellos stand ich lebendig vor meiner Mutter, doch sie benahm sich als würde ich bereits im Sterben liegen, oder Ähnliches! Zwischen Schreck und Sorge um mich, wechselte ihre Stimmung. Wer hat schon mal versucht eine erschreckte Glucke zu beruhigen? Ich brauchte einige Anläufe bis ich meine Mutter zum Zuhören bewegen konnte. Bis dahin hatte ich die Erfahrung gemacht, dass sich nur Kinder sehr schwer von einer einmal vorgefaßten Meinung abbringen ließen. Doch auch Erwachsene konnten sich manchmal unvernünftig benehmen. Zum Glück hatte mir der Arzt auch noch so etwas wie eine Visitenkarte mitgegeben. Erst als es mir einfiel, diese meiner Mutter auch noch als Beweis vorzulegen, dass gleich ein Arzt an Ort und Stelle gewesen sei, benahm sie sich wieder normal. Das, was sie mir dann auf meine „Wunden“ schmierte, war viel angenehmer zu ertragen als das Jod von dem Scheusal von Arzt.
Fußnoten
[1] https://www.cilip.de/2004/02/29/ddr-kriminalstatistik-immer-mit-blick-richtung-westen/ https://www.geschichtscheck.de/2016/10/10/war-die-kriminalitaet-in-der-ddr-geringer-als-in-der-brd/
[2] Karte: https://www.google.de/maps/dir/Insterburg,+Oblast+Kaliningrad,+Russland/L%C3%B6bau(Sachs),+L%C3%B6bau/@52.7852821,13.7628315,6z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x46e3e9392d4379df:0x9dcf2cb794c28ad4!2m2!1d21.8311353!2d54.6312721!1m5!1m1!1s0x4708e29ef8503bfb:0xef7b61ac366daefc!2m2!1d14.671941!2d51.099447
[3] Karte: https://www.google.de/maps/place/Engelsdorf,+Leipzig/@51.3372963,12.4442049,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a6ff3573fa7d45:0xb2ff2b2913df2d41!8m2!3d51.3382024!4d12.4799296
[4] Da wird die Mutter kaum gesagt haben dürfen, dass dies ein Geschenk der sozialistischen Bruderarmee war. https://dietrommlerarchiv.wordpress.com/2017/03/09/waffenbruederschaft/amp/ .
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Erbswurst
[6] Die Melden (Atriplex) sind eine Pflanzengattung in der Familie der Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae). Mit etwa 300 Arten ist dies die artenreichste Gattung der Familie. Der Name Melde ist vom „bemehlten“ Aussehen der behaarten Pflanzen abgeleitet.[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Melden
[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittelmarke
[8] Heuer-Ampel https://de.wikipedia.org/wiki/Ampel#/media/File:Heuerampel.png
Was gab’s bisher?
Editorische Vorbemerkung – https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/06/25/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt/ https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/06/00-editorische-vorbemerkung.pdf
Kapitel 1, Die Ballade von den beschissenen Verhältnissen – oder – Du sollst wissen, lieber Leser: Andere sind auf noch ganz andere Weise kriminell – und überheblich. https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/07/29/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-erstes-kapitel/ https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/07/01-erstes-kapitel.pdf
Kapitel 2, In Dönschten, am Arsch der Welt … ach Monika! https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/08/25/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-ii/https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/08/02-ach-monika.pdf
Kapitel 3, Weiter im Kreislauf: Heim, versaut werden, weglaufen, Lage verschlimmern. https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/09/28/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-iii/ https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/09/03-weiter-im-kreislauf.pdf
Kapitel 4, 17. Juni 53: Denkwürdiger Beginn meiner Heimkarriere https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/10/24/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-iv/ 04-beginn-meiner-heimkarriere-17-juni-53_2
Kapitel 5, von Heim zu Heim https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/11/21/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-v/ PDF: 05-von-heim-zu-heim
Kapitel 6, Wieder gut im Geschäft mit den Russen https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/12/09/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-vi/ 06-wieder-gut-im-geschaft-mit-den-russen
Kapitel 7, Lockender Westen https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/01/04/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-vii/ PDF 07-lockender-westen
Kapitel 8, Berlin? In Leipzig lief’s besser. https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/01/09/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-viii/ PDF: 08-berlin-in-leipzig-liefs-besser
Kapitel 9, Aber nun wieder zurück nach Berlin https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/01/17/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-ix/ PDF: 09-aber-nun-wieder-zuruck-nach-berlin
Kapitel 10, Bambule https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/02/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-x/ PDF: 10-bambule
Kapitel 11, Losgelöst von der Erde jauchzte ich innerlich vor Freude https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/06/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xi/ PDF: 11-losgelost-von-der-erde
Kapitel 12, Ihr Lächeln wurde um noch eine Nuance freundlicher. Süßer! https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/07/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xii/ PDF: https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2017/02/12-sc3bcc39fer.pdf
Kapitel 13, Von Auerbachs Keller in den Venusberg https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/19/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xiii/ PDF: 13-von-auerbachs-keller-in-den-venusberg
Kapitel 14, Ein halbes Jahr Bewährungsprobe. Wo? Im Heim! https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/21/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xiv/ PDF: ein-halbes-jahr-bewahrungsprobe
Kapitel 15, Spurensuche – und der Beginn in Dönschten https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/22/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xv/ PDF: https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2017/02/15-spurensuche.pdf
Kapitel 16, Was also blieb uns übrig, als aufs Ganze zu gehen? https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/03/07/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xvi/ PDF: 16 Was also blieb uns übrig
Kapitel 17, War es den Aufwand wert, dieses beschissene Leben vor den Bomben zu retten?! https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/03/09/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xvii/ PDF: 17 War es den Aufwand wert
Kapitel 18, Ich war doch der einzige „Mann“ in der Familie … https://wordpress.com/post/dierkschaefer.wordpress.com/8148 PDF: https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2017/03/18-der-einzige-e2809emanne2809c-in-der-familie.pdf
Kapitel 19, Überhaupt, in der DDR gab es keine Kriminalität. https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/03/19/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xix/ PDF: 19 in der DDR gab es keine Kriminalität
Wie geht es weiter?
Kapitel 20, Wie schnell sich doch die Weltgeschichte ändert!
»Wenn der Richter das gelesen hätte, dann hätten Sie keine zehn Jahre gekriegt.« XVI
 Dieter Schulz
Dieter Schulz
Der Ausreis(ß)ende
oder
Eine Kindheit,
die keine Kindheit war
Sechzehntes Kapitel
Was also blieb uns übrig, als aufs Ganze zu gehen?
Die Grenze war nicht weit und wir würden es auch ohne die Hilfe des Onkels schaffen. Es wäre doch gelacht. Was der konnte, schafften wir schon lange. Die Alteingesessenen im Schlafsaal wollten natürlich Einzelheiten über uns erfahren. Wir logen ihnen einfach die Hucke voll. Sie gaben sich mit dem, was sie über uns erfahren hatten, zufrieden und schliefen auch bald ein. Wir auch. Wer weiß, wann wir wieder in solch frischgemachten Betten schlafen würden. Nach der halb durchwachten vergangenen Nacht schliefen wir auch bald den Schlaf der Gerechten. Die anderen mussten in die Schule, wir waren davon befreit. Dafür durften wir uns im Tagesraum mit Mikado, Halma oder Schach die Zeit vertreiben. Wie wir so schön beisammen saßen, konnte ich meine Kumpane mit meinem neuen Fluchtplan überraschen. Nach der zweiten großen Pause unten auf dem Schulhof begaben wir uns wieder in den Schlafsaal mit dem Hinweis, dass wir Schlaf nachzuholen hätten. Es wurde uns auch gestattet. Wir wurden aber darauf aufmerksam gemacht, dass sich für den Nachmittag einige Herren angemeldet hätten, die noch einige Fragen an uns haben würden. Auch gut. Sollten die fragen, wen sie wollten. Am Nachmittag wollten wir schon über alle Berge sein. Ach so, hier gab es nur Flachland? Egal, dann eben an der Grenze. Ich hatte mich am Stand der Sonne orientiert und erkannte, wo Westen lag. In diese Richtung mussten wir, um an die Grenze zu kommen. Aus dem Haus und über die Mauer waren wir schnell. Direkt zwischen dem Haus und der Mauer wuchs nämlich eine mächtige Eiche. Deren Äste dienten uns als Brücke. Klar, etwas Mut musste man schon aufbringen, um die etwa anderthalb Meter freien Raum zu überspringen und sich an einem Ast festzuhalten. Nur dem Mutigen gehört die Welt! Wir hatten die weite Reise doch nicht unternommen, um sie hier schon wieder enden zu lassen. Oder? Herz gefasst, gesprungen, rübergerobbt. Über die Mauer und nichts wie weg! Die Richtung, in der wir uns bewegten war richtig. Bald sahen wir die ersten Hinweisschilder. Halberstadt[1]. Das musste doch schon in der Nähe der Grenze liegen, wenn ich die Deutschlandkarte richtig im Kopf hatte? Ausgelassen vor Freude darüber, wieder in Freiheit zu sein und den anderen wieder mal ein Schnäppchen geschlagen zu haben, hüpften, ja tanzten wir fast die Straße entlang. Wir hätten ja auch vom Bahnhof aus (wer hätte uns schon so nahe beim Heim gesucht?) einen Zug in Richtung Halberstadt nehmen können. Der Schienenstrang wies zumindest in die Richtung.
Ein „Zimmer“ mit schwedischen Gardinen
Doch gewitzt durch die innerdeutsche Grenze zu Berlin konnte ich mir denken, dass auch hier in dieser Grenznähe ähnliche Kontrollen stattfinden könnten. Auf ein paar Stunden kam es jetzt auch nicht mehr an, bis wir „Drüben“ sein würden. Oh, kindliche Unbeschwertheit. Du kennst nicht die Fallstricke, mit denen Erwachsene dir das Leben zur Hölle machen. In unserer Ausgelassenheit zeigten wir mehr oder weniger den vorbeibrausenden, meist LKW-Fahrern, unseren Daumen. Was wir gar nicht zu hoffen gewagt hatten, traf dann aber doch ein. Einer der vorbeifahrenden ging vom Gas auf die Bremse. Wir liefen schnell hin. „Wo soll es denn hingehen?“ „Halberstadt!“ „In Ordnung Jungs! Springt hinten drauf!“ Ein oben offener, mit grünen Kübeln beladener Kasten nahm uns auf. Und ab ging die wilde Fahrt. Wir ließen uns ordentlich den Wind um die Nase wehen, als wir über das Führerhaus gebeugt den Weg verfolgten, den der Wagen nahm. Das war dann aber auch schon die letzte Nase voller Wind, den wir in Freiheit genossen. Denn zu unserem Entsetzen, bog der Wagen nicht nach links ab, wo das Schild nach Halberstadt wies, sondern brauste mit fast unverminderter Geschwindigkeit in die Rechtskurve. Wir brauchten nicht allzu lange nachgrübeln, wohin die Fahrt uns führen würde. Rechts freies Feld, links freies Feld. Doch nur wenige hundert Meter wuchs in dieser Landschaft ein Gebäudekomplex heraus. Umgeben von einer grün gestrichenen Mauer. Durch das weit geöffnete Tor brauste der Wagen auf den Hof. Hatten wir ein „Glück“! Unser freundlicher Fahrer brachte gerade das Mittagessen aus irgendeiner Großküche zu seinen Kollegen von der Grenzpolizei. Soweit konnte diese also gar nicht mehr entfernt sein. Das nützte uns aber herzlich wenig. Für uns war die Grenze wieder einmal unerreichbar geworden. Natürlich bekamen wir von den Bullen kein Mittagessen ab. Das mussten wir unter hämischem Grinsen der Anderen im Heim einnehmen. Mahlzeit! Durch diesen Vorfall gewarnt kamen wir nicht wieder in unseren alten Schlafsaal. Man hatte hier vielleicht schon schlechte Erfahrungen mit anderen Aspiranten gemacht. Für solche Kunden hatte man sogar ein „Zimmer“ mit schwedischen Gardinen[2]. Durch das Hineinzwängen von vier Betten wurde es ziemlich eng. Für uns aber sehr gemütlich. Außer dass sich mehrere Herren die Zähne mit ihren Fragen an uns ausbissen und wir ein Spielemagazin zu Verfügung hatten, gab es kaum Abwechslung. Wir waren selbst sehr gespannt darauf, wann man endlich dahinter kommen würde, wohin wir gehörten. Unter den Bullen, die uns bisher vergeblich in dieser Beziehung vernommen hatten, musste doch ein etwas helleres Köpfchen dabei gewesen sein. Zwei von uns sächselten aber zu sehr, als dass das nicht auffallen konnte. Man hatte anscheinend ganz richtig in diese Richtung recherchiert. Nach ca. drei Wochen kam einer der Herren uns im Tagesraum triumphierend entgegen, als hätte er eine Glanztat vollbracht, dabei war es nur reine Routinearbeit gewesen, und verkündete mit vor Stolz geschwellter Brust, dass man nun wisse, woher wir ‚Früchtchen’ (also doch ein Standardsatz, der bei der Polizeischule gelehrt wurde) kämen. Eine komplette Namensliste mit Heim und Heimanschrift las er uns vor. Na bitte, dann konnte unsere Rückreise ja beginnen! Mehr als von meinem Onkel, dass wir auf den Weg nach „Drüben“ waren, konnten sie in ihren Akten nicht vermerken. Waren die vielleicht blöd!? Nach einer weiteren Wartezeit von zwei Tagen hatte man endlich eine Tante vom Jugendamt aufgetrieben, die uns zurück nach Dönschten bringen sollte. Die Trapo[3] in Leipzig sei auch schon informiert teilte sie uns mit. Dort würden wir bis zum Weitertransport unsere Zeit überbrücken. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Von denen hatte ich schon längst die Schnauze gestrichen voll.[4]
Schon bei dem Wort „Pissen“ zuckte sie furchtbar zusammen
Ich hatte schon gar keine Lust mehr, überhaupt so weit mitzufahren. Auch diese Dame hatte einen Vierkantschlüssel, womit sie Zugabteiltüren öffnen und schließen konnte, ganz nach Belieben. Sobald einer von uns musste, bemühte sie den Schaffner, der uns bis an die bewusste Tür begleiten musste. Ich hatte sehr bald bemerkt, dass die Dame aus einer besseren Familie stammen musste. Schon bei dem Wort „Pissen“ zuckte sie furchtbar zusammen und bekam einen puterroten Kopf. Das reizte mich dazu, mit den anderen Jungs ein wirklich schlüpfriges Gespräch zu beginnen. Die schliefen ja auch nicht auf einem Baum. In ihrer Stimme lag überhaupt keine Autorität, als sie uns aufforderte, solch schmutzige Worte zu unterlassen. Besonders reißfest waren ihre Nerven nicht gerade. An ihrem Verhalten merkten wir Schlingel, dass sie einer Ohnmacht nahe war. Sie wusste, je länger es dauerte schon gar nicht mehr, wohin sie in ihrer Verlegenheit noch schauen sollte.
Mit fahrigen Bewegungen zupfte sie an ihrem Rock herum und hielt dabei die ganze Zeit den Vierkantschlüssel, das Objekt unserer Begierde, – nicht ihr Körper, wie sie zu glauben schien – zwischen ihren Fingern fest. Irgendetwas musste geschehen. Wir näherten uns Leipzig mit D-Zug-Geschwindigkeit. Draußen lief der Schaffner vorbei und verkündete den nächsten Zughalt. Ich glaube, will es aber nicht beschwören, es war Schkeuditz[5]. Unsere Begleitdame, so sehr sie sich auch unserer Gegenwart schämte, schien nicht bereit zu sein, uns aus dem Abteil zu werfen. Etwas nachhelfen mussten wir schon noch. Während Peter einen besonders schmutzigen Witz erzählte, den ich sogar behalten habe, hier aber nicht wiedergeben kann, lauschten sie meinem leisen Vorschlag, den ich ihnen zu machen hatte, um aus diesem Abteil und rechtzeitig in Schkeuditz (?) aus dem Zug zu kommen. Das sei ein tolles Stück, fanden sie. Ich auch. Aber nur am Tage war ich Narr. Nachts weinte ich auch schon mal unter der Bettdecke. Immer nur den Abgebrühten spielen, war für meine kleine Jungenseele doch nicht so leicht wegzustecken, wie es den Anschein haben mag.
Was also blieb uns übrig, als aufs Ganze zu gehen? Alles, was ich an Männlichkeit zu bieten hatte, holte ich, mich direkt vor die Dame aufbauend, aus meiner Hose. Meine Güte, machte die ein Wesen daraus. Wie nur würde sie reagieren, wenn ihr mal was Richtiges unter die Augen kam und nicht nur so ein kleiner Zipfel, wie ich ihn zu bieten hatte. Sie hätte ja reinbeißen können, dann hätte sie ihre Ruhe vor mir gehabt. Dicht genug stand ich ja vor ihr. Aber nein, sie fuchtelte wild mit ihren Händen vor ihrem Gesicht herum und strampelte mit ihren Füßen. Warum nicht gleich so? Der Schlüssel flog ihr aus der Hand, einer der Jungen fing ihn geschickt auf, öffnete die Schiebetüre. Ich musste nur noch den kleinen Zipfel wegstecken und mich den anderen anschließen. Wegstecken musste ich ihn schon, soviel Zeit musste sein. Ich wollte mich ja schließlich nicht zum Gespött der Leute machen, die uns im Zug begegneten. Ach ja, ich hatte mir auch noch die Zeit dazu genommen, die Abteiltür von außen zu verriegeln. Auch das musste sein, weil gerade jetzt der Zug seine Geschwindigkeit zu vermindern begann. Wir kamen unbehelligt aus dem Zug und von ihm weg. Nicht dass wir uns auf direktem Wege auf Leipzig zu bewegten. Oh nein! So leicht wollten wir es den Bullen nun doch nicht machen! Für die restlichen ca. 20 km ließen wir uns zwei Tage Zeit und machten dabei eine Menge Lauben unsicher. Um uns zu ernähren, hatten wir ja unsere Notgroschen noch in der Hose. Das Geld konnte ja nicht ewig reichen. Deshalb verblödete ich mich nicht, in Leipzig wieder für Nachschub zu sorgen. Für dubiose Diebstähle, wie vorgeschlagen wurde, hatte ich nicht viel übrig. Ich war in diesem Metier nicht sehr bewandert und es schien auch nicht kalkulierbar genug, die Beute, die man dabei machte. Wir brauchten Bargeld und nicht irgendwelchen Tand, der erst noch verhökert werden musste. Solange wir uns nicht gerade alle auf einem Haufen aufhielten, und somit unnötig auffallen mussten, sah ich kaum Gefahr darin, erwischt zu werden. Ich fand in der Höhle des Löwen seien wir am besten geschützt. Deshalb hielten wir uns auch ganz kackfrech auf dem Hauptbahnhof in Leipzig auf. Leipzig sollte angeblich der größte Sackbahnhof Europas sein (?). Wie dem auch sei, ich wusste jedenfalls, dass jeder Zug, der hier eintraf, immer auch russische Offiziere ausspuckte. Aus allen Richtungen der DDR kamen sie hier an. Viele davon kamen hauptsächlich nur deshalb hierher, weil sie vor ihrem Heimaturlaub noch schnell ein paar Dinge einkaufen wollten, um ihren Frauen, Müttern und sonstigen Lieblingen etwas Besonderes mitzubringen. Nähere Einzelheiten über mein „Geschäft“ werden an anderer Stelle eingehender behandelt, ohne das ich deswegen Geheimnisse preisgebe, die nicht schon längst überholt wären. An guten Tagen, wenn ich nur intensiv genug arbeitete, vorausgesetzt, es war genügend Soore[6] auf dem Markt, konnte ich mit Leichtigkeit an so einem Tag mehr verdienen, als der Monatslohn eines Bullen ausmachte.
Härte wurde abverlangt und, gezeigt!
An den nächsten Tagen lief alles wie geschmiert. Übermütig geworden, nicht ich, aasten die Bengels mit dem Geld herum. Wir dachten uns nicht viel dabei, als eines Abends S. nicht zu unserer Laube zum Schlafen kam. Er war wohl wieder mal bei seinem Bruder. Er stammt aus Leipzig. Unsere Alarmglocken schlugen erst an, als es bereits zu spät war. Grelles Scheinwerferlicht und hereinstürmende, bewaffnete Bullen (oder war es umgekehrt?) rissen uns aus dem wohlverdienten Schlaf. Den Grund unseres Entdecktwerdens sahen wir dann auf dem Polizeirevier, wohin wir gebracht wurden. Nein, nicht angetrunken, nicht betrunken, sturzbesoffen war unser lieber Mitausreißer S., den wir dort wiederfanden. Ich wunderte mich nur, wie die Bullen etwas aus diesem Suffkopp hatten herausbekommen können, vor allen die präzise Lage unserer Laube. Zu seiner Schande gestand er uns, dass er es selbst nicht mehr wüsste, wo man ihn aufgelesen, was er ihnen alles erzählt hatte. Schicksal! Das Kind war in den Brunnen gefallen. Da half auch kein Vorwurf etwas. Mit Hallo und der obligatorischen Verhaue wurden wir wieder in Dönschten empfangen.
Peter und ich passten uns danach wieder dem Heimleben an, bemühten uns die Dinge für den kommenden Weihnachtsmarkt fertig zu machen. Ich war glücklich Monika, wieder zu sehen und schmachtete zu ihrem Fenster hinauf.
Nur zwei aus unserer 27er Kindergruppe durften über Weihnachten nach Hause fahren. Wir restlichen verbliebenen erlebten ein ziemlich trostloses Weihnachtsfest. Briefe von zu Hause wurden so oft gelesen, bis sie von den Tränen sich aufzulösen begannen. Natürlich sah das niemand. Ausheulen tat man sich nicht vor den Augen anderer. Selten dass man solch einen Intimfreund hatte, dem man auch seine wahren Gefühle anvertrauen konnte. Es war schon ein Kreuz mit den Gefühlen. Zur Härte erzogen, sich gegen jeden und alles stellend, um sich einigermaßen durchsetzen zu können, waren wir doch alle nur kleine Jungs, die sich viel lieber mal an die Mutterbrust gekuschelt hätten, als den starken „Mann“ vorzukehren. Ob einer Rücksicht auf die Gefühle anderer genommen hätte? Nicht einmal Kinder untereinander akzeptierten die Gefühle des anderen. Gefühle wurden als Schwäche ausgelegt. Schwäche erbarmungslos ausgenutzt. Solange man sich nicht selbst bei einer Gefühlsduselei erwischen ließ. Nach außen hin ließ man sich eher auseinanderreißen als Gefühle zu zeigen. Zusammenbrechende Herzen ließen keine Geräusche nach außen dringen. Härte wurde abverlangt und, gezeigt!
Tja, man muss manchmal im Kreis laufen, um auf den richtigen Weg zu gelangen. Ich habe begonnen mein Leben zu beschreiben an einer Stelle, die viele Fragen offen lässt, wie es zu diesem Leben überhaupt kommen konnte. Ich habe meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Wie mich meine Erinnerungen eingeholt haben, so habe ich es angefangen niederzuschreiben. Bewusst auf meine Vergangenheit gelenkt gaben dann in der Folgezeit die Hirnzellen noch viele Erinnerungen preis. Nebelschleier hoben sich, gaben längst vergessen Geglaubtes wieder frei. Manche gravierende Vorfälle wurden hinter diesem Vorhang deutlich sichtbar, andere nur verschwommen. Um das Bild aber abzurunden, so finde ich, muß der Hintergrund noch weiter aufgehellt werden. Wenn ich so daran zurück denke wie meine Jungs groß geworden sind, glaube ich schon, dass meine Kindheit etwas Besonderes war. Diese aufzuzeigen, ob das etwas bringt? In dem Sinne, dass es Menschen zur Besinnung bringt, und davon überzeugt, wie sinnlos Kriege sein können, MÜSSEN! Bevor ich schildere, wie es mir dann doch gelungen ist in den „goldenen Westen“ zu flüchten, was mich dort erwartete, möchte ich doch zuerst noch mehr von mir berichten.
Vater, du Arsch hast nur vom Krieg und den Puffs geschwärmt.
Zu dem Zeitpunkt, als ich gebohrt [sic![7]] wurde, hatte Großdeutschland schon damit begonnen, sein Tausendjähriges Reich wieder zu zerstören. Meiner Rechnung nach muss das im April 1940 geschehen sein. Mir ist nicht bekannt (solch ein gutes Verhältnis konnte ich zu meinem Vater nie aufbauen), ob ihn seine Beschäftigung zum Zeitpunkt meiner Geburt – 27.01.41 – ebenso viel Freude bereitet hat, wie die, als ich von ihm gebohrt wurde. Das Wenige, was ich in der Folgezeit über meinen Vater erfuhr, war, dass er in seinem Beruf keine Perspektive mehr sah. Er war Schweitzer von Beruf[8], wie er seine Kuhbauerntätigkeit zu beschönigen versuchte. In Deutschland scheint dieser Berufsstand ausgestorben zu sein, sofern es ihn überhaupt mal gab. Tatsache ist, dass er auf einem großen Rittergut (wir waren aber keine Rittersgutbesitzer, wie sich viele geflüchtete Ostpreußen damit schmückten, als der Zusammenbruch perfekt war und sie, ohne dass es groß nachgeprüft werden konnte, sich als solche ausgaben) haufenweise Kühe gemolken hat, auch etwas von der Behandlung kranker Kühe verstand und Milch zu Butter verarbeiten konnte. Kuh-Schäfer, würde ich sagen, wäre der richtige Ausdruck für seine Beschäftigung gewesen. Für seine Tätigkeit, und dafür, dass der Rest der Familie im Laufe des Jahres bestimmte Tage des Jahres dem Junker seine Felder zu bestellen hatte, Kinder nicht ausgenommen, dafür durften sie im Winter ja auch zur Schule gehen, bekam er eine Behausung gestellt und ein paar Morgen Land[9] zur eigenen Nutzung. Kötter[10], nannte man wohl solche billigen Arbeitskräfte. Wie dem auch sei, ich habe eine sehr, sehr schwache Erinnerung daran, dass mein Vater mal als Weihnachtsmann verkleidet bei uns zu Besuch war. Es kann sich dabei nur um das Weihnachtsfest 1942 oder 1943 gehandelt haben. Mein größerer Bruder bekam einen Panzer geschenkt. Aufgezogen rasselte er durch die Wohnstube und aus seinem Rohr vorne kamen kleine Blitze. Richtig stilgerecht zu damaliger Zeit. Was ich erhielt, dass entzieht sich meinem Erinnerungsvermögen. Fasziniert hat mich eben nur der Panzer. Ich weiß nur noch, dass ich mehr schlecht als recht das Weihnachtsgedicht „Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich bitte nicht…..“ aufsagte und meinen eigenen Vater dabei nicht unter seiner Maske und Verkleidung erkannte. Ich kannte ja noch nicht einmal seine Stimme. Die hörten wohl mehr seine Untergebenen, die er an seiner Flak befehligte. Mein Vater hatte rechtzeitig erkannt, dass es doch besser sei, sich dem Herrenmenschentum anzuschließen und auch dabei helfen, den Krieg zu gewinnen, damit auch er, der Kuhjunge, ein Stück vom Braten abbekam. Nur verdiente Helden sollten damit belohnt werden, einmal über andere Menschen zu herrschen. Armer alter Narr. Gegen Kriegsende hast du dir einen Bauchschuss eingehandelt. Du hattest Glück im Unglück. Du kamst in amerikanische Gefangenschaft und nicht in russische, was wohl Sibirien bedeutet hätte. Ich habe später viele von daher wiederkehren sehen. Denen ging es gar nicht so gut, wie dir, als ich dich nur wenige Jahre später vorfand. Aber ich will nicht vorgreifen. Zunächst ging es uns ja auch ganz gut. Obwohl kein Vater im Haus war, brauchte Mutter keine Hand zu krümmen, um das Land und den Stall zu bewirtschaften. Dafür bekamen wir polnische Kriegsgefangene.[11] Du, Vater, hast meiner Mutter zum Vorwurf gemacht, anscheinend nur, um deine eigenen Unzulänglichkeiten zu verdecken, sie hätte sich mit diesen Plenjis ins Heu gelegt. Du Arsch hast gar nicht gemerkt, wenn du bei den wenigen Gelegenheiten, die wir miteinander verbrachten, vom Krieg und den Puffs schwärmtest, dass du dich doch selbst widersprochen hast. Dir kann ich den Segen nicht geben, den ein Toter sonst von seinen Kindern bekommt. Später, Vater, werde ich noch mehr mit dir ins Gericht gehen müssen!
Ich sehe meine Mutter auf einem Schwein reiten.
Bilder aus der Zeit, die nur an mir vorüber huschen, die ich versuche einzufangen, um sie naturgetreu wiedergeben zu können, kommen auf mich, desto mehr ich in meiner Vergangenheit grabe. Ich sehe meine Mutter auf einem Schwein reiten. Nicht, dass sie dafür eine besondere Begabung gehabt hätte oder eine Zirkusnummer einstudieren wollte. Eines dieser Mistviecher war aus dem Stall ausgebüchst und trieb sich im Obstgarten herum. Das Fallobst war viel zu kostbar, so fand es wohl meine Mutter, als dass es von Schweinen aufgefressen werden sollte. Sie jagte das Schwein aus dem Obstgarten. Versuchte es zumindest. In seiner eigenen Panik lief das Vieh meiner Mutter genau zwischen die Beine. Die Beine meiner Mutter waren nicht gerade die längsten. So kam es, dass sie das Schwein, oder das Schwein meine Mutter, durch den Obstgarten ritt. Nichts Weltbewegendes, werden Sie jetzt sagen. Für mich schon! Das sind nur ganz wenige Augenblicke meiner Kindheit, der ich mich erfreuen konnte. Alles was danach kam, war nur noch Stress und Kampf ums Überleben. Wofür eigentlich?
Fußnoten
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Halberstadt
[2] Falls der Begriff inzwischen veraltet sein sollte: Gemeint sind Gitter vor dem Fenster. Schweden war als bedeutender Eisenexporteur bekannt.
[3] Die Transportpolizei (Trapo) war die Bahnpolizei der Deutschen Demokratischen Republik. https://de.wikipedia.org/wiki/Transportpolizei
[4] Schulz: Das Warum erfahren sie in einem der nächsten Kapitel.
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Schkeuditz
[6] Sore steht für ein Wort der deutschen Gaunersprache für (Hehler-)Ware, Diebesgut oder Beute, das aus Jiddisch sechoro „Ware“ entlehnt ist. https://de.wikipedia.org/wiki/Sore
[7] Kein Druckfehler. Schulz meint damit den Geschlechtsverkehr, der zur Zeugung führt..
[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_(Beruf)
[9] https://de.wikipedia.org/wiki/Morgen_(Einheit) https://www.aid.de/forum/index.php/forum/showExpMessage/id/47131/page1/3/searchstring/+/forumId/3
[10] https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6tter
[11] Der dürfte so ausgesehen haben: 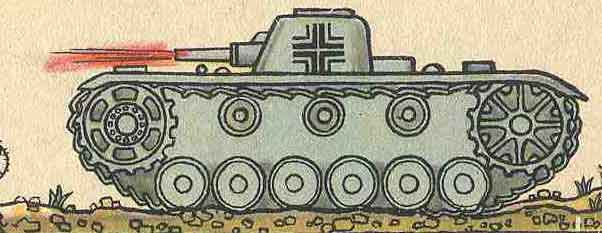 Quelle: NSDAP, Weihnachten, „Kinder malen“, S. 9a
Quelle: NSDAP, Weihnachten, „Kinder malen“, S. 9a
[12] http://www.expolis.de/schlesien/texte/maas.html
Was gab’s bisher?
Editorische Vorbemerkung – https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/06/25/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt/ https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/06/00-editorische-vorbemerkung.pdf
Kapitel 1, Die Ballade von den beschissenen Verhältnissen – oder – Du sollst wissen, lieber Leser: Andere sind auf noch ganz andere Weise kriminell – und überheblich. https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/07/29/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-erstes-kapitel/ https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/07/01-erstes-kapitel.pdf
Kapitel 2, In Dönschten, am Arsch der Welt … ach Monika! https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/08/25/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-ii/https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/08/02-ach-monika.pdf
Kapitel 3, Weiter im Kreislauf: Heim, versaut werden, weglaufen, Lage verschlimmern. https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/09/28/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-iii/ https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/09/03-weiter-im-kreislauf.pdf
Kapitel 4, 17. Juni 53: Denkwürdiger Beginn meiner Heimkarriere https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/10/24/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-iv/ 04-beginn-meiner-heimkarriere-17-juni-53_2
Kapitel 5, Von Heim zu Heim https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/11/21/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-v/ PDF: 05-von-heim-zu-heim
Kapitel 6, Wieder gut im Geschäft mit den Russen https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/12/09/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-vi/ 06-wieder-gut-im-geschaft-mit-den-russen
Kapitel 7, Lockender Westen https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/01/04/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-vii/ PDF 07-lockender-westen
Kapitel 8, Berlin? In Leipzig lief’s besser. https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/01/09/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-viii/ PDF: 08-berlin-in-leipzig-liefs-besser
Kapitel 9, Aber nun wieder zurück nach Berlin https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/01/17/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-ix/ PDF: 09-aber-nun-wieder-zuruck-nach-berlin
Kapitel 10, Bambule https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/02/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-x/ PDF: 10-bambule
Kapitel 11, Losgelöst von der Erde jauchzte ich innerlich vor Freude https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/06/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xi/ PDF: 11-losgelost-von-der-erde
Kapitel 12, Ihr Lächeln wurde um noch eine Nuance freundlicher. Süßer!https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/07/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xii/ PDF: https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2017/02/12-sc3bcc39fer.pdf
Kapitel 13, Von Auerbachs Keller in den Venusberg https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/19/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xiii/ PDF: 13-von-auerbachs-keller-in-den-venusberg
Kapitel 14, Ein halbes Jahr Bewährungsprobe. Wo? Im Heim! https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/21/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xiv/ PDF: ein-halbes-jahr-bewahrungsprobe
Kapitel 15, Spurensuche – und der Beginn in Dönschten https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/22/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xv/ PDF: 15 spurensuche
Kapitel 16, Was also blieb uns übrig, als aufs Ganze zu gehen? https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/03/07/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xvi/ PDF: 16 Was also blieb uns übrig
Wie geht es weiter?
Kapitel 17, War es den Aufwand wert, dieses beschissene Leben vor den Bomben zu retten?!
Kapitel 18, Ich war doch der einzige „Mann“ in der Familie …
Kapitel 19, Überhaupt, in der DDR gab es keine Kriminalität.
Kapitel 20, Wie schnell sich doch die Weltgeschichte ändert!
»Wenn der Richter das gelesen hätte, dann hätten Sie keine zehn Jahre gekriegt.« XIV
 Dieter Schulz
Dieter Schulz
Der Ausreis(ß)ende
oder
Eine Kindheit,
die keine Kindheit war
Vierzehntes Kapitel
Ein halbes Jahr Bewährungsprobe. Wo? Im Heim natürlich!
Ich gab mir alle erdenkliche Mühe, meinen schlechten Ruf wieder loszuwerden.
Aus diesem Paradies wurde ich aber gleich zu Beginn des Jahres gerissen. Mit trauriger Miene, es war auch noch eine andere Person vom Jugendamt dabei, wurde mir mitgeteilt, dass die Behörden nun doch anderweitig über mich entschieden hatten. Höheren Orts wollte man dem Frieden nicht so recht trauen und war auch der Meinung, dass mein früheres Verhalten gegenüber der Obrigkeit eine Strafe verdient hätte. Ich müsste mich ein halbes Jahr lang erst noch bewähren, bevor man mich endlich zu G. und M. lassen würde. Man hatte auch schon ein passendes Heim für mich gefunden. Wie gesagt würde ich dort bis zu den großen Ferien, ohne einmal auszureißen und mit guten Zensuren aufwarten können, stünde einer Rückkehr hierher zu G. und M. nichts im Wege. Machtlos, dennoch mit besten Vorsätzen ließ ich mich nach Weißwasser[1] verfrachten. Es flossen ein paar Tränen und auch etwas Wodka, dann ging es los.
Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Bei meiner Ankunft im Pestalozzi-Heim war mein Ruf mir schon vorausgeeilt. D.h. etwa acht oder neun der Kinder aus Revolutionszeiten waren schon vor mir da. Ich gab mir alle erdenkliche Mühe, meinen schlechten Ruf wieder loszuwerden. Ich war aufmerksam in der Schule, schrieb die besten Aufsätze, zeichnete am besten und vertrat sogar den Russischlehrer, der überlastet war, da er auch noch eine Schule in Weißwasser selbst mit seinem Gefangenschaftsrussisch beglückte. Ich durfte aktiv an der Wandzeitung mitwirken, welche sogar vom Kreis der Stadt prämiert wurde, wofür ich prompt bei den Jungen Pionieren aufgenommen wurde.
Ich beteiligte mich an der Volkstanzgruppe, mit welcher wir beim Weltpioniertreffen in Berlin-Wuhlheide im Sommer sogar vierter wurden. Zweiter wurden wir mit unserem Fanfarenzug. Ich bastelte mit an einem Paddelboot, dass wir nur aus Zeitungspapierstreifen, Leim und Lack herstellten, nachdem wir lediglich den Kiel vom Schreiner erhalten hatten.
Ich baute brav und korrekt mein Bett, zeigte jeden Morgen saubere Hände und Fingernägel, helle Socken und tadellos geputzte Schuhe vor dem allmorgendlichen Fahnenappell vor. Ich wurde zum Zirkelleiter gewählt und erhielt bald darauf das rote Halstuch der jungen Pioniere der Sowjetunion als besondere Auszeichnung auf Intervention des russischen Stadtkommandanten von Weißwasser.
Diese winzig kleine Garnison russischer Soldaten hatte mich samt Ihren Offizieren ins Herz geschlossen. Es begann eigentlich ganz harmlos. Ich wollte nur einen losen Kontakt knüpfen, um meine Sprachkenntnisse an den Mann zu bringen und eventuell auch mal ein paar Mark abstauben. Das Heimgelände war so gut wie offen. Kein Mensch kümmerte sich groß um einen, wenn man nur seine Schulaufgaben vorgezeigt hatte, und andere Gruppenverpflichtungen nicht darunter litten.
Kurz vor dem 8. Mai trat ich dann an den Fanfarenzugleiter, der auch gleichzeitig einer unserer Erzieher war, heran und bat ihn unseren sowjetischen Freunden doch eine angenehme Überraschung bereiten helfen. Unser Fanfarenzug bestand zu derzeit aus: Zwei Landsknecht- und zwei Flachtrommeln, sechs Fanfaren (ohne Ventil) und einem Tambourmajor. In diesem Fanfarenzug, der noch im Aufbau begriffen war, versuchte ich mich zunächst beim Blasen der Fanfare. Aber ich war damals schon ein wenig schwach auf der Brust.[2] So schleppte ich dann eben mit nicht weniger stolzgeschwellter Brust eine Landsknechttrommel mit mir herum. Dafür durfte ich auch gleich in der ersten Reihe marschieren, hinter dem Tambourmajor her. Wir durften im Kulturhaus den Ernst Thälmann Film[3] einweihen. Wir waren ja Ernst Thälmann Pioniere![4]
Am 1. Mai 1954 wurden wir von Birkenlaubblättern grünumkränzten Treckern mit Anhängern, die trotzdem furchtbar nach frischem Mist stanken, abgeholt. In Allerhergottsfrühe wurden wir über die umliegenden Dörfer gekarrt, um die Einwohner mit unserer Blechmusik und Trommelwirbel aus ihrem Feiertagsschlaf zu holen, damit sie ja auch nicht die Maikundgebung versäumten. Es war schon ein erhebendes Gefühl, wie wir, die jungen Pimpfe …. Pardon, habe ich Pimpfe geschrieben? Stammte dieser Ausdruck nicht aus einer anderen Zeit?[5] Aber, wenn ja, was unterschied uns Junge Pioniere denn von denen? Sicher die Uniformen waren etwas anders geschneidert und hatten auch eine andere Farbe. Die Koppel waren anders geprägt, die Parolen lauteten anders,…. Was noch? Wir halfen den Erwachsenen das Aufstehen erleichtern!? Weil mir das ganze so viel Spaß gemacht hatte und ich den Russen außerdem eine Freude bereiten wollte, bat ich also unseren Chef darum, am 8. Mai den Fanfarenzug für deren Zwecke einzusetzen. Das Ehrenmal habe ich 1990 dort gleich wieder gefunden, die Garnison allerdings nicht mehr. Bei dem Ehrenmal standen an ihrem größten Feiertag nach der Oktoberrevolution sämtliche russischen Soldaten und Offiziere und gedachten ihrer gefallenen Krieger des zweiten Wertkrieges. Wir hatten es geschafft, uns unbemerkt von den Russen im Hintergrund zu verstecken. Gleich nach der Ansprache des Stadtkommandanten ließen wir unser „Brüder zur Sonne…“[6] erschallen. Keiner der dort Anwesenden konnte sich seiner Tränen erwehren. Ich heute, beim Schreiben der Zeilen und der Erinnerung daran, auch nicht! Diese Herzlichkeit für so einen kleinen Gefallen hatten wir nun doch nicht erwartet. Wir wurden in das Haus (Kaserne konnte man das nicht nennen) der Soldaten gebeten und bewirtet. Das hatte schon nichts mehr mit Kommunismus oder großer Politik zu tun, dass war eine menschliche Regung. Bei allen Beteiligten. Die Presse machte da natürlich mehr draus. Aber das kümmerte uns nicht. Wir waren nur etwas traurig, als ein paar Tage später unser Heim-Mal-Fest stattfand, und der fest versprochene Gegenbesuch nicht anrollen wollte. Während wir noch bei den Vorbereitungen waren, fuhren die paar Jeeps und Lastwagen in rasender Fahrt an unserem Grundstück vorbei. Noch nicht einmal gewunken haben sie, als sie in Richtung polnischer Grenze vorbei brausten. Viel später kamen sie dann doch noch. Es kam aber keine rechte Stimmung auf. Wie ich erfahren konnte, hatten sie einen Kameraden (Deserteur) an der Neiße jagen müssen. Es ist auch geschossen worden. (Ich roch sachverständig an ihren Gewehrläufen.) Es wurde aber nicht gesagt, ob die Jagd in irgendeiner Weise erfolgreich gewesen war. Um auf unseren eingeseiften Maibaum raufzuklettern waren sie zum einen nicht in der richtigen Kleidung, zum anderen nicht so recht in Stimmung nach dem Vorfall. Dabei hatten wir extra für sie ein paar schöne Würste besonders hoch am Kranz angebracht, wo nur Männerarme hinreichen konnten, sofern sie den glitschigen Stamm erklimmen würden. In einer wurstähnlichen Verpackung hatten wir als besondere Überraschung sogar eine Pulle Korn versteckt, in der Hoffnung, dass der Kommandant dafür ein Auge zudrücken würde. Schade, dass unsere Revanche nicht in dem Maße angenommen werden konnte, wie wir sie uns gewünscht hatten. Dafür revanchierten sich die Russen wiederum bei uns. Eines Tages bat der Stadtkommandant unseren Heimleiter darum, mich, Mischa, mit nach Dresden nehmen zu dürfen, weil er, wie er angab mich dort als Dolmetscher benötigen würde. Dieser ungeschickte Lügner! Er selbst sprach so gut Deutsch, wie ich Russisch. Zu unser beider Glück bemerkte der Heimleiter diesen Schwindel nicht. Ich durfte mit nach Dresden. Wer wagte auch schon einem Stadtkommandanten eine Bitte abzuschlagen, und sei der Grund auch noch erschwindelt? Anfangs glaubte ich ja, dass die Fanfaren und Trommeln, die er mit meiner Hilfe aussuchte, dafür dienen sollten, um in seiner Garnison selbst einen derartigen Musikzug aufzustellen. Ich glaubte das übrigens bis zu dem Zeitpunkt, als wir abends aufs Heimgelände fuhren. Als dann aber ein Begleitoffizier und der Soldatenfahrer die Instrumente abzuladen begannen, da dämmerte es mir. Heimleiter, die Kinder und ganz besonders der Leiter unseres Musikkorps, die vom Motorenlärm angelockt auf dem Vorbau standen, bekamen ihre Münder vor Staunen gar nicht mehr zu. Was sind dagegen die 100 Mäuse, die ich im Winter 1990 für die Russlandhilfe einzahlte, wie ich sie eben erübrigen konnte? Erst mit so vergrößertem Fanfarenzug konnten wir ein paar Monate später die Endkämpfe unter den besten 28 Fanfarenzügen der DDR als Zweiter verlassen. Dass wir nicht den ersten Platz belegten, lag an mir. Hätte ICH Dussel nicht gepatzt, wären wir locker Erster geworden. Unsere Musik, d.h. unser Solobläser war einsame Spitze. Keiner der Anwesenden konnte die Oktavenleiter so hoch hinaufklettern wie er. Aber nicht nur die Musik alleine wurde gewertet. Im großen Stadionrund mussten wir einmal die Außenbahn umrunden und dabei drei Stücke vortragen. Die Jury achtete dabei auch sehr auf Disziplin. Nicht dass ich nicht inzwischen keine Disziplin angenommen hätte. Nein! Ich war einfach zu nervös, so plötzlich im Mittelpunkt von zigtausenden von Menschen zu stehen. Bei der „Lok“, einem rasanten Trommelwirbel, flog mir doch eine der Filzkugeln vom Schlegel. Ich Idiot! Anstatt ein paar Takte auszusetzen, den Reserveschlegel aus der Spannschlaufe zu ziehen und einen geeigneten Moment abwartend bis ich wieder sicher war den Takt zu treffen, sause ich der entspringenden Filzkugel hinterher, stecke sie wieder auf den Stock und komme prompt auch noch in den falschen Takt hinein. Ich kann mich kaum erinnern, mich in meinem Leben noch einmal derartig geschämt zu haben. Ich hatte in Weißwasser soviel um die Ohren, war dermaßen ausgelastet mit Dingen, die mir auch Spaß machten, weil ich endlich mal beweisen konnte, dass etwas in mir steckt, wenn man mich nur forderte, das ich gar nicht an Fluchtpläne dachte. Außerdem hatte ich ja auch eine Perspektive, sobald ich mich unter Beweis gestellt haben würde. Die Umgebung Weißwassers war damals zumindest noch sehr naturbelassen. Ich lernte etwas vom Angeln, Schlittschuhlaufen, Eishockey, und noch mehr von der Natur kennen.
Ich lernte auch wieder mal erkennen, dass, wenn Erwachsene etwas versprachen, nicht unbedingt darauf Verlass war. Dass man mir während der Osterferien noch nicht die Reise nach Leipzig erlaubte, konnte man mir gerade noch plausibel machen. Die großen Ferien wurden lange vorher verplant. Für alle, die nicht nach Hause konnten oder durften, war ein Ferienlager vorgesehen. Ein Ferienlager in einem staatlichen Forst.[7] Weitab von der nächsten Ortschaft, die nur über einen riesigen, ehemaligen Braunkohleabbau-See zu erreichen war. Es wurde das Gelände auf einer Karte vorgezeichnet. Ein Voraustrupp sollte dort die Wasserabzugsgräben, Latrinen und die obligatorische Fahnenstange für den allmorgendlichen Fahnenappell installieren und für genügend Frischwasser sorgen. Ich fühlte mich geehrt, dem Voraustrupp beigeordnet zu sein, reklamierte aber doch das Versprechen ein.
Kinder müssen immer wieder feststellen, dass die Erwachsenen sich ihr eigenes Recht wie eine Hure zurechtlegen.
Meine Zeugnisse waren trotz Versäumnissen sehr gut ausgefallen. Ich hatte mir nur ganz selten bei den oben beschriebenen Appellen einen Minuspunkt eingehandelt, war zu jeder Sonderveranstaltung mitgenommen worden, was ja wohl auf gute bis sehr gute Führung schließen ließ. Ja doch, ich hätte ja in allen Punkten recht, nur diese Tatsache müsste in Leipzig bei der Jugendbehörde erstmal zur Kenntnis genommen werden, was während der großen Ferien ja kaum möglich wäre. Auch die Behörden würden jetzt größtenteils Ferien machen. Nach den Ferien, wurde ich vertröstet. So lernte ich noch das urwüchsige Lager-Zeltleben kennen. Auch nicht schlecht, dachte ich. Schrieb einen lieben Brief an meine Mutter und einen an G. und M., verbrachte ein Zeltlagerleben mit nächtlicher Wache am Dauerlagerfeuer mit einem Luftgewehr bewaffnet, lernte Uferschwalben und deren riskante Bauweise kennen, durfte ihre stoische Ruhe bewundern, wie sie unverdrossen wieder neue Höhlen bauten sobald eine ganze Wand voller Nester ins Wasser abgerutscht war. Ich fing den ersten (einzigen) Hecht meines Lebens und Barsche jede Menge. Ruderte kilometerweit übers Wasser, um Frischwasser in Tonnen zu holen. Konnte mich an der Rettungsaktion beteiligen, um einen Erzieher und eines unserer kleinsten Mädchen aus dem Wasser zu fischen, weil das selbstgebastelte Paddelboot eben nur ein Paddelboot, aber nicht zum Segeln ausgetrimmt war. Oder einfach nur die Segel falsch bedient wurden? Wer kann das schon sagen. Der Erzieher, der die Blamage nicht eingestehen wollte, meinte jedenfalls, dass der Kiel des Bootes daran schuld sei, dass er das Boot zum Kentern brachte. Na ja, die Erwachsenen haben ja immer Recht. Sollen sie ja auch haben, ihr Recht. Nur, immer auf Kosten der Kinder, die sich dagegen schlecht wehren können? Gegen ihr Recht! Kinder müssen immer wieder feststellen, dass die Erwachsenen sich ihr eigenes Recht wie eine Hure zurechtlegen, damit es ihnen persönlich am besten be-(kommt!). Meine Hasskappe hatte ich bei G. und M. wieder abgelegt. Bald nach der Rückkehr vom Ferienlager begann ich wieder danach zu schielen.
Ich war hart gegen mich selbst.
Die wenigen, die über die Ferien nach Hause gedurft hatten, sofern sie eines hatten, ein Zuhause, schwärmten uns anderen davon vor. Merkten gar nicht, wie weh sie all den anderen taten, die keine Eltern(teile) mehr hatten. Oder, wie ich, nicht gedurft hatten. Die Schule begann wieder. Ich begann zu quengeln. Alles half nichts. Ich wurde vertröstet. Der russische Stadtkommandant, der seine Familie bei sich hatte, der sich kaum noch vorstellen konnte, wieder von seiner Familie getrennt leben zu müssen, der Krieg hatte ihn lange genug davon getrennt, über diesen Mann ließ ich meine diesmal unkontrollierte Post laufen. Mutter heulte sich die Augen aus, wie sie mir schrieb. G. und M. wurden schon etwas konkreter in ihrem Brief. Auch sie bemühten sich in Leipzig um meine Rückkehr. Wie es aber schien, ließ man mich wissen, hatten die Behörden gar nicht im Sinn, ihr Versprechen einzulösen. Man ließ G. gegenüber durchblicken, dass meine gute Führung lediglich zweckgebunden gewesen sei und keineswegs zu erwarten sei, dass ich im geordneten Leben bei einer Familie diese Führung auch bestätigen würde. Von daher sei es geboten, mich mindestens noch ein Jahr lang zu erproben. G. und M. besuchten mich dann kurz darauf auch noch heimlich in Weißwasser. Tatsache, so führten sie persönlich aus, sei aber, das hatte G. in der Eigenschaft als Polizistin erfahren, ohne dass die Auskunftsperson von unserem Verhältnis (der familiären Bindung, was dachten Sie denn?) wusste, man eigentlich nur noch eine geeignete Strafmaßnahme für mich suche. Das, was ich bisher angestellt hätte, könne ja letztendlich nicht auch noch belohnt werden. So! Jetzt wusste ich wenigstens, wo der Hase lang lief. Warum nur glaubten die Erwachsenen bei Kindern mit Lügen besser ihre Ziele erreichen zu können?
Und wieder die Hasskappe aufgesetzt
„Was, du willst nicht essen? Dann, bitte, blühe, wachse und gedeihe!“ Dieser Spruch, vom Tischende kommend, wo der jeweilige Erzieher saß, der gerade Dienst hatte, kam immer dann, wenn einer am Tisch quatschte oder sonst einen Unfug anstellte. Der so Aufgeforderte durfte dann den Rest der Mahlzeit hinter dem Stuhl stehend verbringen, egal ob er nun schon satt war oder gerade erst mit dem Essen begonnen hatte. Dieser Spruch erreichte mich in den letzten sieben Tagen bei allen drei Mahlzeiten. Ich durfte hinter dem Stuhl stehend mit ansehen, wie die anderen sich die Bäuche mit Essen voll schlugen, während ich der Heimleitung noch nicht einmal die Genugtuung gab, mich bei Wassersaufen auf der Toilette erwischen zu lassen. Ich war hart gegen mich selbst. Ich hoffte, damit endlich etwas zu erreichen. Zumindest eine klare Aussprache über meinen weiteren Weg. Pustekuchen. Die waren ja noch sturer als mein ostpreußischer Dickschädel. Die zogen noch nicht einmal einen Arzt zu Rate. Am siebten Tag wurde es Ihnen anscheinend dann doch zu bunt. Zu jeder Mahlzeit mussten wir uns gruppenweise in Reih und Glied aufstellen und im Gänsemarsch, sobald der Befehl dazu gegeben wurde, in den Speisesaal begeben. Es ging natürlich nicht an, dass etwas im Heim geschah, was dessen Ruf geschädigt hätte. Im Sozialismus wurden alle Kinder zu ordentlichen Menschen erzogen, ohne dass sie einen Grund zur Klage hatten.
„Radfahrer“ fanden sich überall, wie es auch korrupte Beamte immer geben wird. Solch einen „Radfahrer“ hatten wir auch in unserer Gruppe. Den „Goldenen Lenker“ hatte er schon, jetzt wollte er sich nur noch die Pedale vergolden. Dieser Fiesling stand am siebten Tag beim Ausrücken zum Abendessen in der Reihe direkt vor mir. Ein kurzer Ellenbogencheck nach hinten, genau in meine Magengrube, ließ mich die ganze Welt nur noch in rosa Licht erleben. Dann wurde mir schwarz vor Augen. Hätte ich noch was im Magen gehabt, ich glaube ich hätte mich ausgekotzt. Ich schlief bis zum nächsten Morgen durch. Beim Frühstück hatte ich keine Widerstandskraft mehr. Man hatte mich wieder zur Räson gebracht. Alles stand wieder zum Besten. Glaubte man. Da ich mir bisher noch keine Gedanken über eine Flucht gemacht hatte, begann ich nunmehr darüber nachzudenken. Ich wollte aber nicht verduften, ohne mich für den gemeinen Ellenbogencheck revanchiert zu haben. Ich hatte noch einen ganz miesen Trick drauf, womit ich selbst den stärksten Mann dazu bringen konnte, nach meiner Pfeife zu tanzen. Ich erwähnte ja bereits, dass man im Leben manchmal ein wenig brutal sein muss, um sich durchboxen zu können. Ich wusste aber auch von der schwachen Blase, die mein erklärter Feind hatte. Dieses Wissen machte ich mir zunutze. Ich hielt mich bewusst eines nachts solange wach, bis mein Spezi zum Klo musste. Ich schlich hinter ihm her. Entschuldigen Sie bitte meine Hinterlist. Aber ich war gerade in die siebte Klasse versetzt, der Gegner aber hatte schon zweimal die gleiche Klasse durchlaufen und war bereits in der achten Klasse. Bedeutend größer und stärker. Kurz vor dem Klo trat ich ihm von hinten auf den Pantoffel, er kam ins Straucheln, ich gab ihm noch einen Schubs, er verlor das Gleichgewicht und seinen Hausschuh, wie ich auch beabsichtigt hatte, ohne den mein Trick nicht geklappt hätte, und ich stürzte mich auf seinen nackten Fuß. Blitzschnell, anders geht es meistens schief, griff ich mit Mittel und Zeigefinger seinen großen „Onkel“ und umklammerte diesen fest. Etwas daran drehen, wie man das manchmal scherzhaft mit der Nase eines Kindes tut, und schon hatte ich einen ganz lammfrommen Bengel an meiner „Angel“. So, fest im Griff, konnte ich dem Burschen sogar verbieten zu jammern. Seine Tränen, die ihm aus den Augen schossen, gönnte ich ihm. Aufstehen lassen durfte ich ihn allerdings nicht. So musste er mit Hilfe seiner Hände und des einen freibeweglichen Fußes eben sehen, wie er meinen Wünschen nachkam. Ich musste ihn unbedingt nach draußen bringen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wirklich, nur ganz leise wimmernd, folgte er mir auf dem Fuße. Pardon! Auf zwei Händen und einem Fuß. Die Fahnenstange[8] auf dem Appellplatz war sehr solide gebaut. Mit einem zusätzlichen Strick, den ich dort schon wohlweislich versteckt hatte (es geht doch nichts über eine gute Planung vor der Tatausführung!) band ich den Bengel dort fachgerecht an der Fahnenstange fest, ohne zu vergessen, seine beiden großen Zehen, diesmal mit Schnürsenkeln, am Fahnenaufzugsseil zu befestigen. Damit er auf keine dummen Gedanken kommen konnte, stopfte ich ihm auch noch einen alten Socken ins Maul, verschnürte diesen mit einem weiteren Schnürsenkel um seinen Kopf. Den Socken spuckte er nicht aus! Davon konnten wir uns dann am nächsten Morgen alle überzeugen. Bevor ich ihn noch etwa zwanzig Zentimeter an der Fahnenstange hochzog, pisste ich ihn noch an. Ich wollte den Weg zur Toilette ja nicht noch einmal machen. Mein bisschen Urin macht den Kohl auch nicht fett. Am nächsten Morgen, als er von der ersten Erzieherin, die ihren Dienst antrat, gefunden wurde, hatte er sich selbst bepisst und seinen Schlafanzug vollgeschissen. Der darauffolgende Morgenappell fiel diesmal ganz anders aus als üblicherweise. Anstatt wie an jedem Morgen mit dem Pioniergruß – die rechte Hand alle fünf Finger geschlossen schräg über den Kopf[9] – dem Heimleiter zu melden, dass alle Kinder zum Appell angetreten seien, den Spruch des Tages vorlesen, und den „Fähnrichen“ zuzurufen „Hisst die Fahne“, worauf ein Fanfarenbläser losschmetterte und die Fahne hochgezogen wurde, anstatt den Tag damit zu beginnen, wurde ich in die Mitte des Karrees gerufen. Mir wurde das Rote Halstuch abgenommen und ich in aller Öffentlichkeit aus dem Verband der Thälmann-Pioniere verstoßen. Der Stadtkommandant soll geheult haben, als er davon erfuhr. Ich selbst habe das nicht mehr miterlebt. Schon am nächsten Tag, bis dahin wurde ich in der fensterlosen Wäschekammer eingesperrt, hatte man für mich eine neue Bleibe gefunden. Komisch, erst konnte man gar kein Heim für mich finden, dann stand plötzlich ganz schnell eines zu meiner Verfügung.
Im stillen Kämmerlein, wo es nach muffiger Wäsche roch, konnte ich mich schon mal innerlich von Weißwasser verabschieden.
- Ein paar gute Freunde hatte ich gewonnen. Auch wenn ich ihnen mal die Bretter, die als Betteinlage dienten, des Abends so schräg gelegt hatte, dass sie nach ein paar Drehungen im Bette unweigerlich durchbrechen mussten. Was zur allgemeinen Erheiterung beitrug, selten bei dem Betroffenen selbst.
- Man war auch schon mal unter eine andere Bettdecke gekrochen, hatte sich im Dunkeln Geschichten erzählt und … am Piephahn gespielt.
- Man hatte den Mädchen im Dunkeln Fledermäuse in den Schlafraum geschmuggelt. Einer musste deswegen mal fast eine Glatze geschnitten werden, weil die arme verängstigte Fledermaus sich mit ihren kleinen Krallen in ihrer Mähne verfangen hatte.
- Man hatte fast allen Mädchen schon unter den Rock geschaut und mehr. Je nach Temperament hatte man etwas auf die Finger bekommen, oder auch nicht!
- Die Lagerfeuerwache, zwischen zwei und vier, wo man beinahe eingeschlafen wäre, hätte es das Mädchen nicht so spannend gemacht, doch wach zu bleiben.
- Die kleinen Zettelchen, die man hier und da erhielt, worauf meistens das gleiche stand – „Willst du mit mir gehen?“ oder – „Ich liebe dich!“… Unterschrift. Ja, Monika Feurig (so hieß sie wirklich!), Brigitte Zabel und und … ich habe euch alle geliebt! Auf meine Art. Meine kindhafte Art! Diese Art von Liebe, die nur in der Kindheit so problemlos ist, wie sie ist!
- Auch dich, kleiner Wolle, habe ich geliebt. Du hattest niemanden mehr auf der Welt. Du warst eines von den Vollwaisenkindern in Weißwasser. Du liefst mir überallhin nach. Ich habe dich beschützt, weil du, zwar schon 15, aber noch kleiner warst als ich. Ich konnte deine Liebe verstehen, die du den Tieren entgegen gebracht hast. Woran solltest du deine Liebe sonst hängen? Du bekamst keins dieser Zettelchen von einem der Mädchen. Weißt du, die Mädchen schauen zu oft nur nach dem Äußeren, oder auf das, was du bist. Deine inneren Werte wurden übersehen. Aber auch ich musste schon mal über dich lachen. Du hattest dir eine Ringelnatter als Haustier erkoren, diese des Nachts sogar in dein Bett geschmuggelt. Hast Fakir mit ihr gespielt, sie dir um den Hals gewickelt. Eine Zeitlang hast du mit der Schlange sogar etwas Eindruck bei den Mädchen gemacht. Bis sie erfahren mussten, dass dieses Reptil vollkommen ungefährlich ist. Zumindest solange, wie man nicht allergisch dagegen ist. Durch den direkten Hautkontakt mit der Schlange, jemanden anders hattest du ja nicht zum Berühren, sahst du bald wie ein Streuselkuchen aus. Das war auch der einzige Grund, weshalb ich jemals über dich gelacht habe.
- Bald würdet ihr den besten Luftgewehrschützen unter euch ausmachen können. Gegen mich hattet Ihr keine Chancen. Ich traf einfach alles, ob es eine Streichholzschachtel war, oder einen hüpfenden Frosch, die Wachskugeln schlugen überall dort ein, wo ich hinschaute. Ein Naturtalent nannte man mich.
In der Wäschekammer, wo ich eine fast schlaflose Nacht verbrachte, setzte ich auch wieder meine Hasskappe auf. Hass in mir auf die Erwachsenen im Allgemeinen, kam hoch. Kaum einer hatte etwas dagegen unternommen dem Schleckelhuber[10] das Handwerk zu legen. Ohne die Millionen Mitläufer wäre es nicht zu dem gekommen, dass ich aus meiner behüteten Familie und meiner angestammten Umgebung, Heimat genannt, gerissen worden wäre. Mir wäre eine normale Entwicklung meiner Kindheit beschieden gewesen. Eure Herrenmenschenträume sind zusammengebrochen, aber die Manieren nach dieser katastrophalen Niedertage habt ihr nicht abgelegt. Wenn ihr schon nicht andere Völker unterdrücken konntet, so konntet ihr doch wenigstens euer Mütchen an den unschuldigen Kindern auslassen, die ihr erst in diese Lage gebracht hattet. Solche und ähnliche Gedanken beschäftigten mich und raubten mir den Schlaf.
Verabschieden von meinen Leidensgenossen konnte ich mich am nächsten Tag auch nicht mehr. Sie waren in der Schule, als ich abgeholt wurde. Viele aber hatten sich am Abend und bis in die Nacht hinein an meine Türe geschlichen und mir alles Gute gewünscht.
Fußnoten
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fwasser/Oberlausitz hier: http://heimkinder-forum.de/v4x/index.php/Thread/15487-Wei%C3%9Fwasser-Kinderheim-Makarenko/ oder hier: http://www.kinder-heim.de/board1818-virtuelle-stadt-der-heimkinder/board1851-wohngebiet/board1732-spezialkinderheime-der-ehemaligen-ddr/board1735-spezialkinderheime-von-r-bis-z/board1804-spezialkinderheim-wei-wasser-maxim-gorki/
[2] Schulz: Später wird man lesen können, dass ich mit offener TBC und drei Löchern in der Lunge in einer Heilstätte landete.
[3] http://www.zeit.de/1954/13/der-ostzonale-thaelmann-film https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Th%C3%A4lmann_%E2%80%93_F%C3%BChrer_seiner_Klasse
[4] http://www.ddr-geschichte.de/Bildung/Schule/Pionierorganisation/pionierorganisation.html https://de.wikipedia.org/wiki/Pionierorganisation_Ernst_Th%C3%A4lmann
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Jungvolk
[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCder,_zur_Sonne,_zur_Freiheit
[7] Schulz: Woanders sonst, als eben staatlich?
[8] Schulz: Die stand 1990 bei meinem Besuch immer noch dort.
[9] http://www.ddr-geschichte.de/Bildung/Schule/Pionierorganisation/pionierorganisation.html
[10] gemeint ist Schicklgruber, eine Lächerlichmachung Adolf Hitlers mit Bezug auf den ursprünglichen Namen seines Vaters. https://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Hitler
Was gab’s bisher?
Editorische Vorbemerkung – https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/06/25/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt/ https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/06/00-editorische-vorbemerkung.pdf
Kapitel 1, Die Ballade von den beschissenen Verhältnissen – oder – Du sollst wissen, lieber Leser: Andere sind auf noch ganz andere Weise kriminell – und überheblich. https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/07/29/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-erstes-kapitel/ https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/07/01-erstes-kapitel.pdf
Kapitel 2, In Dönschten, am Arsch der Welt … ach Monika! https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/08/25/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-ii/https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/08/02-ach-monika.pdf
Kapitel 3, Weiter im Kreislauf: Heim, versaut werden, weglaufen, Lage verschlimmern. https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/09/28/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-iii/ https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/09/03-weiter-im-kreislauf.pdf
Kapitel 4, 17. Juni 53: Denkwürdiger Beginn meiner Heimkarriere https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/10/24/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-iv/ 04-beginn-meiner-heimkarriere-17-juni-53_2
Kapitel 5, von Heim zu Heim https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/11/21/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-v/ PDF: 05-von-heim-zu-heim
Kapitel 6, Wieder gut im Geschäft mit den Russen https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/12/09/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-vi/ PDF: 06-wieder-gut-im-geschaft-mit-den-russen
Kapitel 7, Lockender Westen https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/01/04/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-vii/ PDF 07-lockender-westen
Kapitel 8, Berlin? In Leipzig lief’s besser. https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/01/09/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-viii/ PDF: 08-berlin-in-leipzig-liefs-besser
Kapitel 9, Aber nun wieder zurück nach Berlin https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/01/17/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-ix/ PDF: 09-aber-nun-wieder-zuruck-nach-berlin
Kapitel 10, Bambule https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/02/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-x/ PDF: 10-bambule
Kapitel 11, Losgelöst von der Erde jauchzte ich innerlich vor Freude https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/06/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xi/ PDF: 11-losgelost-von-der-erde
Kapitel 12, Ihr Lächeln wurde um noch eine Nuance freundlicher. Süßer! https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/07/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xii/ PDF: https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2017/02/12-sc3bcc39fer.pdf
Kapitel 13, Von Auerbachs Keller in den Venusberg https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/19/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xiii/ PDF: 13-von-auerbachs-keller-in-den-venusberg
Kapitel 14, Ein halbes Jahr Bewährungsprobe. Wo? Im Heim! https://dierkschaefer.wordpress.com/2017/02/21/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt-xiv/ PDF: ein-halbes-jahr-bewahrungsprobe
Wie geht es weiter?
Kapitel 15, Spurensuche – und der Beginn in Dönschten
Kapitel 16, Was also blieb uns übrig, als aufs Ganze zu gehen?
Kapitel 17, War es den Aufwand wert, dieses beschissene Leben vor den Bomben zu retten?!
Kapitel 18, Ich war doch der einzige „Mann“ in der Familie …
Kapitel 19, Überhaupt, in der DDR gab es keine Kriminalität.
Kapitel 20, Wie schnell sich doch die Weltgeschichte ändert!
»Wenn der Richter das gelesen hätte, dann hätten Sie keine zehn Jahre gekriegt.« VI

Dieter Schulz
Der Ausreis(ß)ende
oder
Eine Kindheit,
die keine Kindheit war.
Sechstes Kapitel
Wieder gut im Geschäft mit den Russen
Trotzdem dass ich sofort wieder bei den Russen ins Geschäft kam, hielt es mich nur vier Tage in der Freiheit. Ich wäre sonst vor Hunger gestorben. Seitdem weiß ich auch wie sich ein einsamer Wüstenwanderer fühlen muss. Die Taschen voller Gold, aber nichts zu trinken! Ich hatte zwar gleich wieder reichlich Bargeld, konnte aber mit meiner dick geschwollenen Lippe nichts essen.
Ich war dann direkt froh, als mich mein Freund und Helfer aufgriff und wieder ins Heim brachte. Dort bekam ich zwar auch keine ärztliche Behandlung, weil angeblich daran ohnehin nichts mehr zusammenzunähen ging, aber man schob mir einen dünnen Schlauch in den linken Mundwinkel und ließ mich so gut es eben ging dünne Puddingsuppen schlürfen.
Dauernd kamen und gingen Kinder und Jugendliche. Nur ich blieb und blieb in der Herberge. Diesmal in einem Zimmer mit vergittertem Fenster. Ende Juli dann wurde ich mit noch zwei anderen Jungen in ein Auto gesteckt und los ging es, Richtung Dresden. Welch eine unvergessliche Fahrt. Bald kamen wir an die Elbe, wie uns gesagt wurde. Rechterhand konnte ich die Meißner Burg auf einem Berg aufragen sehen, wo ein gewisser Böttcher das Weiße Gold [1] erfunden hatte. Ohne den wahren Wert zu kennen aßen wir zuhause täglich von dem edlen Geschirr mit dem Blauen Zwiebelmuster. Auch Riesa[2] passierten wir, welches ich einige Monate später noch etwas näher kennenlernen sollte. Einen längeren Riesa-Aufenthalt verschaffte uns die Wasserschutzpolizei von der Elbe.
Das Elbsandsteingebirge auf der gegenüberliegenden Seite der Elbe – auf dieser Fahrt begann ich Deutschland kennen zu lernen.
Ein Holzvergaser
Vor allem erfuhr ich so auch, dass Deutschland nicht nur aus Flachland besteht. Ostpreußen, meine eigentliche Heimat, war ebenso flach wie das Leipziger Umland. Was anderes kannte ich bis dato ja auch noch nicht. Und, sehr oft war ich ja auch noch nicht mit einem Auto gefahren worden. Schon garnicht mit einem so nostalgischen wie dem, womit wir nach Dresden gebracht wurden.
Es war nämlich ein Holzauto. Nein, nicht das Auto bestand aus Holz, wie Sie jetzt vielleicht annehmen. Das Auto wurde mit Holz angetrieben. Hinten, wo normalerweise der Kofferraum bei einem Auto ist, hing ein riesiger Kessel der mit Holz beheizt wurde[3]. Diese Heizung trieb wiederum den Motor an. Da wir ziemlich oft anhalten mussten, um den Heizkessel zu befeuern, und die Geschwindigkeit auch nicht gerade berauschend war, hatten wir genügend Muße uns die Landschaft einzuprägen. Wie viele lebende Menschen mag es wohl noch geben, die das Vergnügen hatten, mit solch einem Auto gefahren zu sein?
Dresden, Dresden-Hellerau, genauer gesagt. Ein riesiges Kasernengelände nehme ich an, welches die Russen nicht für sich in Anspruch genommen hatten. Ansonsten wimmelte Hellerau ja von russischen Soldaten. Hitler hatte ihnen ja, als er sie nicht mehr benötigte, die Kasernen großzügigerweise überlassen. Dort wurden auch, wie ich gerüchtehalber hörte, russische Soldaten erschossen, die sich geweigert hatten dem Schießbefehl am 17. Juni nachzukommen. Ich glaube zwar, dass sich einige unserer sowjetischen Freunde geweigert hatten zu schießen, aber dass welche deswegen erschossen wurden? Väterchen Stalin war doch schon längst hinter der Kremlmauer verscharrt worden. Ich will nicht erst noch lange in Geschichtsbüchern irgendetwas nachlesen.
Spakonje notsch, Josef Dschugaschwilli!
Ich möchte es so niederschreiben wie es mir das Gedächtnis eingibt. Von daher weiß ich, dass ich doch schon wenige Tage nach seinem Tode sein Denkmal vor dem ehemaligen Opernhaus auf dem Karl-Marx-Platz in Leipzig von seinem Sockel gestürzt sah. Was hatten wir bis dahin nicht alles gutes von Väterchen Stalin in der Schule eingebläut bekommen. Armer kleiner Großer Stalin, immer diese undankbaren Menschen. Da reißt du dir während der Revolution den Arsch auf, befreist das russische Volk von der Diktatur des Zaren, stutzt die Deutschen auf ihre richtige Größe zurecht, befreist ganze Völker vom Hitlerjoch, hast dir einen großen Brocken von Deutschland einverleibt, gibst den Polen und anderen Verbündeten auch noch was ab, und kaum hast du das Zeitliche gesegnet, mögen sie dich nicht mehr. Dabei waren unsere Schulbücher voll von deinen guten Taten, ich hatte gelernt, dass du, Stalin, eigentlich Dschugaschwilli heißt, und ein ganz normaler Georgischer Bauernjunge warst.[4] Jetzt sollte auf einmal das meiste nicht mehr stimmen? Gar nicht so einfach für einen jungen Menschen, das Gelernte einfach zu verwerfen. Spakonje notsch[5], Josef Wiserianiwitsch Dschugaschwilli!
In dem Heim in Dresden-Hellerau lernte ich auch einen deiner Zweitweltkriegshelden kennen. Oleg Koschewoi![6] Er lebte damals allerdings schon längst nicht mehr. Denn lebende Helden sind selten. Helden sind meistens tot.
Lebende Helden? Man sieht ja was aus dir geworden ist, weil du, Stalin, schon zu Lebzeiten den Orden eines Helden der Sowjetunion getragen hast, wurdest du posthum zum Antihelden erklärt. Warst ja auch nicht viel besser als Hitler. Ich hoffe ihr beiden habt euch in der Hölle, wo ihr beiden euch bestimmt wiedergetroffen habt, viel zu erzählen. Ach ja, Oleg Koschewoi, nach dem die Gruppe benannt wurde, in die ich nun zum erstenmal in ein richtiges Heim gekommen war, sollte uns allen als Vorbild dienen. Sollte uns Vorbild sein, was unter Kameradschaft zu verstehen war. Schließlich hatte sich Held Oleg über eine böse deutsche Handgranate geworfen, um seine Kameraden vor den sicheren Tod zu bewahren. Dafür war er dann alleine ein bisschen tot, aber als Held gestorben. Seine heldenhafte Tat war groß an die Wand unseres Tagesraumes gemalt. Damit wir auch ja immer daran erinnert wurden, was es hieß, sich immer und überall für den anderen einzusetzen. Die Erzieher waren davon natürlich ausgenommen. Als ich nämlich mal einen Einsatz für mich in Anspruch nahm, bekam ich nur eine schallende Ohrfeige. Es war ja aber auch nur eine Lappalie, weswegen ich den Erzieher anging. Er hatte soviel um die Ohren, dass er meinte, dass wir uns selbst gegenseitig erziehen müssten und nicht wegen jedem Dreck zu ihm gelaufen kämen. Ich wollte ihm doch nur klar machen, das ich einfach keine Lust hatte, einem der größeren, stärkeren Jungs (fast alle in der Gruppe waren größer und stärker als ich!) jeden Abend einen runterzuholen.
Was ist mir von Hellerau noch in Erinnerung? Meinen ersten Walnussbaum in meinem Leben sah ich dort. Ich lernte dabei, dass die milchige Masse in der Fruchtschale um diese Jahreszeit keineswegs essen durfte. Da aber wäre es beinahe schon zu spät gewesen. Woher sollte ich auch wissen das die Nuss in diesem Stadium besonders viel Zyankali enthielt? Weil die Frucht mir so gar nicht schmeckte, warf ich sie weg und entkam ich dem Schicksal Goebbels. Auch diesmal bekam ich wieder eine Ohrfeige, nachdem ich dem herbeigerufenen Arzt meine Übelkeit erklärt hatte. Nicht aus Sorge bekam ich die Ohrfeige, wie ich sie schon mal von meiner Mutter erhielt, sondern weil ich mich an einem volkseigenen Nussbaum vergriffen hatte. So erkannte ich, dass die Erzieher doch manchmal Zeit für uns Kinder übrig hatten.
Ansonsten aber gefiel mir Dresden überhaupt nicht
Die großen Ferien bewahrten uns davor in die Schule gehen zu müssen. Dafür lernte ich den Dresdner Zwinger und einen angeblich 100 Jahre alten Karpfen im Zwingergraben kennen. Das Innere des Zwingers und die darin enthaltenen Kunstschätze bekamen wir nicht zusehen. Der Eintrittspreis war bei unserem Kulturausflug nicht inbegriffen. 1990, als ich wieder in Dresden war, hatte ich zwar das Geld für den Eintritt, dafür aber waren die Kunstschätze über die ganze Stadt verteilt. Überall nur Gerüste und Steinmetze im Zuge der Renovierung. Nur das Prähistorische Museum war geöffnet. Aber von dem, was ich dort zu sehen bekam, hatte ich schon bessere Sachen gesehen. Ich fand, dass es das Geld nicht wert war, was einem dort geboten wurde. Ebenso waren die Preise im Restaurant der Semper-Oper bei weitem nicht gerechtfertigt. Na ja, die blöden Wessis, die endlich auch diese Stadt wieder besuchen durften, hatten es ja. Man versuchte jetzt mit aller Macht an die gute DM zu kommen, um die marode EX-DDR Wirtschaft wieder aufzupäppeln.
Von Hellerau kommend überquerte ich schon acht Jahre nach Kriegsende das Blaue Wunder von Dresden. Wie wir erfuhren, hatten die bösen Engländer die kulturhistorische Stadt Dresden mit ihren Bomben in Schutt und Asche gelegt.
Ergriffen hörten wir zu als man uns erzählte, dass es dabei so viele Tote gegeben hätte, dass man die Menschen gar nicht mehr begraben konnte. Sie wurden zu Haufen aufgeschichtet, mit Benzin übergossen und angezündet, um einer Pest vorzubeugen. Bei der Erzählung unseres Stadtführers schien es mir als würde ich in das Jahr 1944 zurück versetzt, als auch bei uns in Königsberg die britischen Bomber ihre todbringenden Lasten abwarfen. Fast spürte ich den Geruch wieder in der Nase. Staubig und beißend wie damals. Ich glaube, dass der gute alte Stinkbombenraucher den Russen diese schöne alte kulturträchtige Stadt nicht im heilen Zustand gegönnt hatte, und deshalb die Stadt schnell noch ein paar Tage vor Kriegsende in Trümmer gelegt hat. Die Kriegsgewinnler, die Industriebarone, werden sich sicherlich über jede Bombenbestellung gefreut haben. Welchen anderen Grund sollte er sonst gehabt haben. Der Ausgang des Krieges war doch schon längst entschieden. In Dresden gab es keine nennenswerte Kriegsindustrie mehr, und die Zivilbevölkerung war nicht, wie in Königsberg, zum letzten bereit. Es waren hauptsächlich Flüchtlinge. Vertriebene aus längst besetzten Ostgebieten in der Stadt. Wie gesagt; die Rüstungsindustrie in England hatte anscheinend noch ein paar Bomben zuviel auf Lager, die unbedingt weg mussten.
Während der Ferien in Dresden bekam ich auch meinen letzten Schliff was das Schwimmen betraf. Bis dahin konnte ich mich gerade mal mehr recht als schlecht über Wasser halten. Alles das hatte ich mir selbst beigebracht. Schulschwimmen? Das war ein Satz mit großem X. Das war wohl NIX! Um meine körperliche Mickrigkeit mit Mut zu überbrücken ließ ich mich dazu hinreißen einen Köpper vom Zehnmeterturm zu machen. Wenn es Zwei aus der 30 köpfigen Gruppe wagten; konnte ich das schon lange. Lange hatte ich dann auch etwas davon. Nicht nur die Hochachtung der übrigen. Aber bevor ich zugegeben hätte das ich beim Aufkommen auf dem Wasser mir beinahe die Rippen gebrochen hätte, hätte ich lieber noch einmal den gleichen Sprung gewagt. Ich war seitlich rechts so flach auf das Wasser geknallt das ich glaubte über Beton zu surfen. Tausende Nadelstiche auf meiner Haut, knallrot meine rechte Seite. Der Erzieher lobte mich zwar vor der ganzen Gruppe, was mich den Schmerz leichter ertragen ließ, grinste mich aber schadenfroh an, während er bedeutungsvoll meine rechte Seite streichelte. Dafür wiederum hätte ich ihn ohrfeigen können. Das brannte nämlich wie Feuer.
Ansonsten aber gefiel mir Dresden überhaupt nicht. Ich wollte nach Hause zu Mutter und meiner Schwester. So ein zusammengewürfelter Kinderhaufen, na ja, und erst die Erzieher, dass war nun wirklich kein richtiges Zuhause.
Gleich beim ersten Ausreißversuch aus Hellerau ging auch gleich alles schief. Mir nützte selbst mein gutes Russisch nichts. Eher glaubte man in mir einen Spion aus dem Westen zu sehen. Mit den guten Sprachkenntnissen machte ich mich eher verdächtig als beliebt. Wo gab es denn so was, ein deutscher Junge wollte das sein, der ihre Sprache so beherrschte das es fast schon nicht mehr zu glauben war, was er da erzählte. Die Posten, die uns an der Elbe aufgegriffen hatten, konnten oder wollten es nicht glauben, dass wir aus einem Heim ausgerissen waren und nur zu unseren Eltern wollten. Dabei hätten doch gerade die Russen solche Regungen am besten verstehen müssen, pflegten sie doch ihre Familienbande sehr. Der Respekt ihren Eltern gegenüber ging soweit, wie ich es selbst gesehen hatte, dass die Soldaten in ihren Briefen ihre Eltern mit Sie anredeten. Unser Pech war gewesen, dass die Russen ihren ehemaligen Verbündeten, den Amerikanern so gar nicht mehr trauten. Zumal diese sich bei ihren kommunistischen Brüdern in Korea eingemischt hatten. Deshalb standen sie ja jetzt auch gleich mit einer ganzen Flakbatterie an der Elbe, um einer eventuellen Eskalation der Amis begegnen zu können. Der Kalte Krieg war in vollem Gange.
Wie dem auch sei; wir liefen eben solchen Verteidigern des friedliebenden Ostens in die Hände, und wurden prompt wieder im Heim abgeliefert. Früchtchen war anscheinend ein anderer Ausdruck für Fallobst. So nannten und behandelten mich dann auch nach der unfreiwilligen Rückkehr die Erzieher. Der Gruppe Oleg Koschewoi war ich damit nicht zum Vorbild geworden. So sagte man es mir jedenfalls. Da man mich hier sowieso nicht leiden mochte hatte ich mir fest vorgenommen, auch recht bald wieder aus ihrem Blickfeld zu verschwinden, um ihnen das Ärgernis, was ich offensichtlich darstellte, aus den Augen zu schaffen. Nur, das nächste Mal wollte ich besser vorbereitet sein. Aus dem Schulatlas lernte ich zunächst einmal Deutschland kennen. Ich kannte ja kaum etwas von meiner Heimat.
Warum den Russen nicht eine Frau besorgen?
Dann musste es doch irgendwie möglich sein an Reisegeld zu kommen. Deshalb begann ich wieder, mich in der Nähe der russischen Kasernen rumzutreiben. Inzwischen war es noch niemandem aufgefallen, dass mein konfiszierter und später wieder ausgehändigter Taschenspiegel ein Geheimnis verbarg. Für einen Zehner verscherbelte ich diesen an jemanden, der mehr davon hielt als ich selbst. Der junge russische Soldat freute sich über den Erwerb, ich mich über mein erstes Geld. Das reichte natürlich bei weitem nicht. Zumal ich nie gerne alleine reiste. Mit weiteren Spiegeln, nachdem sich das rumgesprochen hatte bei unseren Befreiern vom faschistischen Joch, konnte ich nicht dienen. Dafür aber besorgte ich den Sandlatschern – gemeint sind hier die gemeinen Fußtruppen der Sowjetarmee – ihren geliebten Wodka. Der billige Fusel-Korn wurde von denen als Wodka akzeptiert. Natürlich tranken sie auch ihren Samagonka[7], aber wurden sie mit ihrer Destillieranlage erwischt gab es reichlich Bunker dafür. So wurde mein Kundenkreis immer größer. Wer verdächtigte auch schon einen Dreikäsehoch, Wodka in Kasernennähe zu schmuggeln? Dabei sammelte sich durch die Provisionen ganz schön was an Bargeld in meinen Taschen an.
Durch Zufall (?) trieb sich auch des Öfteren eine junge Frau in der Einöde des Kasernengeländes von Dresden Hellerau herum. In einem gewissen Umkreis des Kasernengeländes durften sich auch die Soldaten ziemlich frei bewegen. Unser Heim war nur durch einen breiten Gürtel verwilderten Gestrüpps und ein paar mickrigen Bäumchen von den eigentlichen Kasernen getrennt. Bis zum Kriegsende gehörte ja das Heimareal samt den Häusern ebenfalls zum Wehrmachtsgelände. Die russischen Soldaten versuchten immer wieder mit der jungen Frau Kontakt aufzunehmen, was aber anscheinend an den Sprachschwierigkeiten scheiterte. Sie hatte ihre Schulzeit schon beendet noch bevor die russische Sprache als Pflichtfach eingeführt wurde.
Das was die Soldaten von der Frau wollten war eigentlich international bekannt. Aber die Frau stellte sich, oder war doof. Schnell erkannte ich, dass hier meine Dolmetscherdienste gefragt waren und bot sie auch zu diesem Zwecke an. Erfahrungen auch auf diesem Gebiet hatte ich ja schon reichlich in Leipzig gesammelt. Na also, warum nicht gleich so. Eigentlich, so schien mir wollten beide Seiten das gleiche. Ich machte natürlich daraus gleich ein Geschäft. Die Frau wollte mir gegenüber erst die beleidigte herauskehren. Nicht weil gleich drei Kerle von ihr das gleiche wollten, sondern weil ich ihr sagte das sie dafür auf die schnelle 30 Märker verdienen könne. Sie wünschte sich so sehr ein paar Perlonstrümpfe aus dem dekadenten Westen. Nur deswegen erklärte sie sich bereit das Geld anzunehmen. Sie gab mir, zum Zeichen und weil die misstrauischen Soldaten darauf bestanden, ihren Ausweis als Pfand. Die Soldaten sammelten 50 Mark, die ich so verstaute, dass die Frau die genaue Summe nicht erkennen konnte.
Schon verkrochen sich alle vier ins tiefe Gebüsch hinein. Ich legte immer großen Wert darauf zufriedene Kunden zu haben, deshalb wollte ich mich auch vergewissern, ob die Frau sich ihr Geld auch redlich verdiente. Ich hätte vorher wohl besser einige Karl May Bücher lesen sollen. Schließlich war ganz in der Nähe Radebeul, das Karl May Museum. Aus den Büchern hätte ich vielleicht lernen können, wie man sich in solch einem Gelände heranschleicht, ohne sich gleich einen Dorn aus dem Brombeerstrauch in die Fußsohle zu treten. Wir liefen ja überwiegend barfuß durch die Gegend, um das wenige Schuhzeug zu schonen. Dafür musste ich mir dann im Heim von einem Arzt den Fuß aufschneiden lassen. Ekelhaft, schmerzhaft das Ganze. Von örtlicher Betäubung hatte der Arzt anscheinend noch nie etwas gehört. Dafür aber ließ er die eigentliche Spitze des Dorns in meiner Fußsohle, der dann Wochen später wieder zu Eitern begann. Erst einmal verkniff ich mir einen Schmerzensschrei.
Was für die gestiefelten Soldaten ein Kinderspiel war, sich einen Weg durchs Gebüsch zu brechen, war für mich zur Tortur geworden. Ich biss also die Zähne zusammen und gelangte auch ans Ziel.
Doch, ich muss schon sagen, ich hatte meine Mutter einige Male auf der Baustelle besucht und gesehen wie sie unser Brot verdiente. Als ausgezeichnete Heldin der Arbeit mit Aktivistenorden, verdiente sie in ihrer 54 Stundenwoche ihr Geld wirklich viel mühsamer als die Frau unter den Soldaten. Wenn ich die Zeit meines Anschleichens mitrechnete hatte sie alles in allem ihre 50, pardon 30 Mark, der Rest gehörte ja mir, in etwa 20 Minuten verdient. Wogegen meine Mutter für die 54 Stunden gerade mal 65 Mark bekam.
Blitzschnell, diesmal ohne mir einen weiteren Dorn einzutreten, war ich wieder zu meinem Platz zurückgekehrt. Die Frau machte ein sehr zufriedenes Gesicht, als ich ihr ihren Ausweis mit 30 Mark darin zurückgab. Rührte das zufriedene Gesicht etwa von der Vorfreude her, sich nun endlich die ersehnten Perlonstrümpfe kaufen zu können? Ich konnte das schlecht beurteilen, ich war noch niemals Frau. Obwohl die Soldaten einen Großteil ihre dürftigen Kröten Monatssold losgeworden waren, machten auch sie zufriedene Gesichter. Ich auch! Zwanzig Mark verdiente man hier in Dresden nicht alle Tage auf einen Schlag. In Leipzig, ja da war das noch ganz anders gewesen. Aber darauf komme ich noch. Anscheinend hielten bei der Frau die Perlonstrümpfe – dass wusste sie vorher schon – nicht sehr lange. Sie erklärte sich bereit in zwei Tagen schon wiederzukommen. Na fein! Es tat mir ja selbst leid, dass ich dann nicht mehr den Vermittler spielen und die Vermittlungsgebühr beanspruchen konnte. Ich machte mir deswegen aber keine Gewissensbisse. Die würden in Zukunft auch ohne mich zurechtkommen.
Fußnoten
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_B%C3%B6ttger
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Riesa
[3] Holzvergaser, https://de.wikipedia.org/wiki/Holzgas
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Stalin
[5] Gute Nacht http://www.speedlearningservice.de/Wissensfabrik/PublicLessons.aspx?lId=24957
[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Alexandrowitsch_Fadejew
[7] Schwarz gebrannter Schnaps, Wodka-ähnlich https://en.wiktionary.org/wiki/samogon
Was gab’s bisher?
Editorische Vorbemerkung – https://dierkschaefer.wordpress.com/2016/06/25/wenn-der-richter-das-gelesen-haette-dann-haetten-sie-keine-zehn-jahre-gekriegt/
https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/06/00-editorische-vorbemerkung.pdf
Kapitel 1
Die Ballade von den beschissenen Verhältnissen – oder – Du sollst wissen, lieber Leser:
Andere sind auf noch ganz andere Weise kriminell – und überheblich.
https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/07/01-erstes-kapitel.pdf
Kapitel 2
In Dönschten, am Arsch der Welt … ach Monika!
Kapitel 3
Weiter im Kreislauf: Heim, versaut werden, weglaufen, Lage verschlimmern.
https://dierkschaefer.files.wordpress.com/2016/09/03-weiter-im-kreislauf.pdf
Kapitel 4
- Juni 53: Denkwürdiger Beginn meiner Heimkarriere
04-beginn-meiner-heimkarriere-17-juni-53_2
Kapitel 5
von Heim zu Heim
Kapitel 6
Wieder gut im Geschäft mit den Russen
06-wieder-gut-im-geschaft-mit-den-russen
Wie geht es weiter?
Kapitel 7
Lockender Westen
Wer Augen hat zu lesen, der lese …
… und ihm werden die Augen aufgehen. Ein emeritierter Professor[1] für alte Sprachen (Richard) gerät eher zufällig, dann aber recherchierend in Kontakt mit schwarzafrikanischen Flüchtlingen. Er entdeckt dabei nicht nur sie, ihre Länder und die dortigen Lebens- und Fluchtbedingungen, entdeckt nicht nur die hiesigen Lebensbedingungen für schwarzafrikanische Flüchtlinge, sondern er entdeckt auch seine Lebensbedingungen in diesem immer merk- und fragwürdiger erscheinenden Deutschland.
Von Jenny Erpenbeck sachkundig und faszinierend geschrieben. Sollte man unbedingt lesen, denn dabei gehen einem die Augen auf – Zyniker und andere Menschenverächter ausgenommen.
[1] (mit DDR-Hintergrund)
Hier ein Auszug:
Jenny Erpenbeck
GEHEN, GING, GEGANGEN
Roman
Die Afrikaner müssen ihre Probleme in Afrika lösen, hat Richard in letzter Zeit häufig Leute sagen hören. Hat Leute sagen hören: Dass Deutschland überhaupt so viele Kriegsflüchtlinge aufnehme, sei sehr großzügig. Im gleichen Atemzug sagen sie: Aber wir können nicht ganz Afrika von hier aus ernähren. Und sagen außerdem: Die Armutsflüchtlinge und Asylbetrüger nehmen den wirklichen Kriegsflüchtlingen, das heißt also den Kriegsflüchtlingen, die auf direktem Wege nach Deutschland kommen, die Plätze in den Asylbewerberheimen weg.
Die Probleme lieber in Afrika lösen. Richard stellt sich einen Moment lang vor, wie ein Erledigungszettel für die Männer, die er in den letzten Monaten hier kennengelernt hat, dann aussehen müsste.
Während auf seinem eigenen Zettel zum Beispiel stünde:
- Monteur für Reparatur Geschirrspüler bestellen
- Termin beim Urologen ausmachen
- Zähler ablesen
würde auf der Erledigungsliste für Karon stattdessen stehen:
- Korruption, Vetternwirtschaft und Kinderarbeit in Ghana abschaffen
Oder bei Apoll:
- Klage gegen den Konzern Areva (Frankreich) einreichen
- neue Regierung in Niger einsetzen, die sich durch ausländische Investoren nicht bestechen oder erpressen lässt
- unabhängigen Tuareg-Staat Azawad gründen (mit Yussuf besprechen)
Und bei Raschid stünde da:
- Christen und Muslime in Nigeria miteinander versöhnen
- Boko Haram davon überzeugen, die Waffen niederzulegen
Zuletzt sollten Hermes, der Analphabet mit den goldenen Schuhen, und Ali, der zukünftige Krankenpfleger, sich gemeinsam um diese beiden Aufgaben kümmern:
- Verbot von Waffenlieferungen an Tschad (USA und China)
- Verbot, im Tschad Erdöl zu fördern und außer Landes zu bringen (USA und China)
Sag einmal, fragt Richard Karon, wie groß müsste ein Grundstück in Ghana sein, von dem sich deine Familie dort selbständig ernähren könnte?
Karon überlegt einen Moment und sagt dann: Ein Drittel vom Oranienplatz etwa.
Und wieviel würde das kosten?
Karon überlegt wieder und sagt: Ich denke, zwischen 2000 und 3000 Euro.
Noch im Sommer vor anderthalb Jahren hätte Richard sich beinahe ein Surfbrett gekauft (1495,- Euro), aber bevor er sich hatte entscheiden können, war schon der Herbst dagewesen, und im letzten Sommer, nachdem der Mann im See ertrunken und nicht mehr aufgetaucht war, hatte ihm natürlich nichts ferner gelegen als der Kauf eines Surfbretts. Dagegen wäre der Kauf eines staubsaugenden Roboters (799,- Euro) sicher auf jeden Fall eine gute Idee, auch einen …
S. 252f
Knaus-Verlag, München, 2015
#DDR-#Zwangsarbeit, Galeria Kaufhof schlägt Opferfonds vor
„Jahrzehntelang haben Häftlinge in der DDR Waren für westdeutsche Unternehmen produziert: Uhren für Quelle, Möbelteile für Ikea, Strümpfe für Aldi. Individuelle Entschädigungen lehnen die Betriebe bis heute ab. Ein Unternehmen ist nach BR-Recherchen jetzt erstmals bereit, über Geld zu sprechen.“
http://www.br.de/nachrichten/galeria-kaufhof-opferfonds-100.html
Wir haben uns über den Runden Tisch ziehen lassen.
Da saß »eine Mischung aus westlichen Politprofis und alten Kadern«[1]
Runde Tische sind oft nicht das, was Gutgläubige sich von ihnen versprechen. So auch hier:
»Hat der Westen die DDR vereinnahmt?
Ich sehe das nicht so einseitig, Es gab auch eine Menge hausgemachter Gründe. Überspitzt gesagt: Wir haben uns über den Runden Tisch ziehen lassen. Ich verteidige bis heute den Runden Tisch als Chance des Kompromisses und des friedlichen Ausgleichs. Diese ganzen freundlichen SED-Gestalten, von Modrow bis Gysi, aber auch die Akteure der Blockparteien, spielten ein doppeltes Spiel: Sie sicherten das politische Leben der SED-Nachfolgepartei oder arbeiteten heimlich mit den westlichen Polit-Profis von der Allianz für Deutschland (die von der CDU angeführt wurde, Anm. d. Red) zusammen, brachten blitzschnell ihre Schäfchen ins Trockene. Sie nutzten die Zeit in klassisch politischer Manier und entschieden den Wahlkampf zu ihren Gunsten. Wir hätten keine Mehrheit erreichen können. Aber mit einem stärkeren Gewicht, mit einigen Prozentpunkten mehr, hätten sich durchaus andere Akzente im Einigungsprozess setzen lassen«.
[1] http://www.sueddeutsche.de/politik/ddr-buergerrechtler-templin-ueber-die-wende-wir-haben-uns-ueber-den-runden-tisch-ziehen-lassen-1.2204315 Montag, 10. November 2014
Ein aufschlußreicher Brief des brandenburgischen Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport.
Der Brief Brandenburg Spezialheime nennt für das Gebiet des heutigen Landes Brandenburg die Zahl von 20.000 Kindern und Jugendlichen, die zur Zeit der DDR in Spezialheimen lebten. [Hochgerechnet auf die 14 ehemaligen Bezirke der DDR könnten es 280.000 Betroffene sein!]
Diese Gruppe hat Anspruch auf Ausgleichsleistungen. Doch das Ministerium sieht rechtliche Hürden im Interesse der Anspruchsberechtigten zu handeln. Denn die Daten der Einzelfälle in sogenannten Beschlußregistern sind nicht öffentlich zugänglich, auch nicht für Amtspersonen ohne Auftrag der Betroffenen; denn ausschließlich die Betroffenen können Akteneinsicht beantragen. Die Daten können also nicht genutzt werden, um ehemalige DDR-Heimkinder über ihre Ansprüche zu informieren. Das geht nur über allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.
Man sieht geradezu die Tränen des Mitleids in den Augen der Ministerin. Dummerweise wurde auch noch eine Antragsfrist beschlossen. Bis Ende September 2014, wenn ich mich nicht irre. Bis dahin wird man wohl leider nicht alle erreichen. Aber „Pech gehabt“ ist ohnehin die Lebenserfahrung dieser Menschen, da darf man sie nicht irritieren. Das hat auch den Vorteil, daß der Fonds wohl ausreichen wird, der 280.00 Anträgen nicht gewachsen wäre.
Noch ‘ne kleine Nachbemerkung:
»Die Anzahl der gestellten Anträge war … unerwartet hoch«
Tja, die könnte noch viel höher sein. Doch man ist wohl noch einmal davongekommen.
Entschädigung und ihr Ausbleiben ist das Eine, der Platz im öffentlichen Gedächtnis das Andere.
»Die Gedenktafelkommission Friedrichshain-Kreuzberg hat das Bezirksmuseum beauftragt, zu prüfen, ob und wie an das ehemalige DDR-Aufnahme- und Durchgangsheim Alt-Stralau erinnert werden soll. Von 1952 bis 1989 befand sich auf der Halbinsel Stralau ein Durchgangsheim, das als Einrichtung der DDR-Jugendhilfe einer vorübergehenden Aufnahme von Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenssituationen dienen sollte. Isolationszellen, Essensentzug, Prügel, militärischer Drill und Zwangsarbeit gehörten dort zum Alltag. Bei einem Expertenhearing sollen angemessene Formen der Erinnerung entwickelt und diskutiert werden. Ehemalige Erzieher/innen und Bewohner/innen des Aufnahme- und Durchgangsheims sollen an der Diskussion beteiligt werden.«
So ein Mail der Geschäftsstelle Gedenktafelkommission Friedrichshain-Kreuzberg an mich.
Manche Leser meines Blogs werden sich fragen, was das soll, solange keine anständige Entschädigung gezahlt wird. Ich denke, daß es wichtig ist, unabhängig von Entschädigungen die Geschichte nicht von Anderen schreiben zu lassen. Die Heimgeschichte ist dabei, denkmals- und museumswürdig zu werden. Die Betroffenen sollten, meine ich, darauf hinwirken, daß nicht nur an die Verbrechen in den Heimen erinnert wird, sondern auch an den Betrug um die Rechte und die Schäbigkeit von Ausgleichszahlungen. Nur so wird die Sache „rund“.
Anbei die Einladung per PDF. Einladung_D-Heim




1 comment